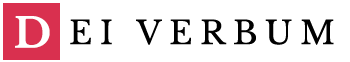den Artikel
Leben wächst von unten. Verflechtungen tief im Erdendreck machen Wachstum erst möglich. Die Mykorrhiza, jenes symbiotische Geflecht von Pilzen und Wurzelwerk, ist die Basis der Versorgung eines Baumes mit Nährstoffen. Die Pilze liefern Salze und Wasser an die Pflanze, die sich ihrerseits mit Kohlehydraten, die als Nebenprodukt der Photosynthese entstehen, revanchiert. Die einen können nicht ohne die anderen sein, denn den Pilzen fehlt die Fähigkeit aufgrund eines Enzymmangels, die lebensnotwendigen Kohlehydrate selbst produzieren zu können; die Wurzeln hingegen sind aus sich nicht in der Lage, die für die Pflanze notwendigen Spurenelemente und das überlebenswichtige Wasser aufzunehmen. Die Verflechtung im Dunkel der Unterwelt schenkt in vielfältiger Weise Leben: ohne Pflanze keine Photosynthese und ohne Photosynthese gäbe es nicht genug Sauerstoff zum Leben für viele Organismen, zu denen auch die Gattung Mensch gehört. Das verborgene Geflecht in der Unterwelt ist ein wahrer Lebendigmacher.
Unterwelt
Die Unterwelt wird unterschätzt. Wer sich hingegen traut, in die Unterwelt hinabzusteigen, dem offenbart sich ein Kosmos eigener Art. Pflanzen kommunizieren hier über die Myzelgeflechte über große Entfernungen. Mutterpflanzen versorgen ihre Abkömmlinge in Zeiten des Anfangs und der Gefährdung mit Nährstoffen. Über Botenstoffe werden sogar Warnungen vor Schädlingen verbreitet, so dass sich andere Pflanzen durch die Produktion entsprechender Substanzen vor ihnen schützen können. Wahrlich, in der Unterwelt ist vieles los, was die scheinbare Immobilität etwa eines Baumes auf den ersten Blick nicht vermuten lässt. Er kann sich nicht selbst genügen. Die Unterwelt stellt ihm ein System im Geben und Nehmen bereit, das es erst möglich macht, dass er in den Himmel wachsen kann. Ob er Früchte bringt, oder nicht – all das hängt auch von den Dingen ab, die sich im Verborgenen abspielen. Unterirdisch muss er sich ausbreiten und soweit es geht, an die Ränder gehen, um dem Licht entgegenstreben zu können. Der Himmel ist eben nicht ohne Erdendreck zu haben.
Systembedingte Tunnelblicke
Nicht jedes System liebt den Erdendreck. Ganz im Gegenteil. Die gnostische Missachtung der Materie hat insbesondere die Kirche von Beginn an bedroht. Das Geistige wird als das Eigentliche geachtet und demzufolge eine möglichst weitreichende Entflechtung von allem allzu weltlichen angestrebt. Die Welt wird dann zum Widerpart des Geistlichen, als sei die Welt nicht die Schöpfung Gottes, durch seinen Sohn ins Sein gesetzt und durch den Geist mit Leben behaucht. Wer so die Kirche von der Welt entheben, ja entweltlichen möchte, schottet die Kirche vom Nährboden ab. Worin soll die Kirche denn Wurzeln schlagen, wenn nicht in der Welt; welchen Teig soll sie den durchsäuern, wenn nicht den der Gesellschaft; welche Saat soll den aufgehen, wenn sie nicht in Erdendreck fällt?
Stattdessen hat die Kirche eine wahrhaftige Meisterschaft im Tunnelbau entwickelt. Jeder Tunnel führt zwar durch untere Welten, von denen man sich aber durch architektonische Artefakte abschottet. Das gibt nicht nur Sicherheit, es hält auch rein und sauber. Jedwede Verflechtung bleibt außen vor. Alles ist künstlich und fein bereitet und man kann ohne Gefahr von Geben und Nehmen mit sich selbst im Reinen bleiben.
Zum systembedingten Tunnelblick gehört vor allem eine Wahrnehmung, die sich selbst im Mittelpunkt wähnt. Das ist nur allzu menschlich, denn der Mensch kann gar nicht anders, als die Welt von sich aus zu definieren. Die Dinge kann er nur von seinem individuellen Standpunkt aus beurteilen. Er ist der Relationspunkt seiner Welt. Problematisch wird es nur, wenn er sich selbst absolut setzt und vergisst, dass um ihn herum andere Menschen existieren, die mit genau derselben Disposition ausgestattet sind. Schafft er diese Selbstrelativierung nicht, ist die narzisstische Enttäuschung vorprogrammiert: Es ist doch wahrhaftig eine Unverschämtheit, dass andere sich im Mittelpunkt der Welt wähnen, wo man doch selbst in eben jenem Mittelpunkt steht.
Der Gefahr des selbstzentrierten, narzisstisch induzierten Tunnelblicks ist insbesondere die Kirche ausgesetzt. Sie wähnt sich ja nicht nur im Besitz des Heiligen. Ihr ist auch verheißen, dass
die Pforten der Unterwelt […] sie nicht überwältigen Matthäus 16,18b
werden. Außerdem verheißt Jesus doch selbst im Johannesevangelium:
Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Johannes 17,16
Die Ränder sind immer weit weg
Die scheinbare Dichotomie von Kirche und Welt, die sich hieraus ergibt, bestärkt nicht nur ein ekklesiales Entweltlichungsstreben; es führt auch zu einer Deformation der Perspektive. Nicht ohne Grund fordert Papst Franziskus in der Enzyklika Evangelii Gaudium eine immobil gewordene Kirche auf, sich in die Welt hineinzubegeben, und eine Kirche fordert,
“die in einem bestimmten Raum Gestalt annimmt, mit allen von Christus geschenkten Heilsmitteln versehen ist, zugleich jedoch ein lokales Angesicht trägt. Ihre Freude, Jesus Christus bekannt zu machen, findet ihren Ausdruck sowohl in ihrer Sorge, ihn an anderen, noch bedürftigeren Orten zu verkünden, als auch in einem beständigen Aufbruch zu den Peripherien des eigenen Territoriums oder zu den neuen soziokulturellen Umfeldern. Sie setzt sich dafür ein, immer dort gegenwärtig zu sein, wo das Licht und das Leben des Auferstandenen am meisten fehlen. Damit dieser missionarische Impuls immer stärker, großherziger und fruchtbarer sei, fordere ich auch jede Teilkirche auf, in einen entschiedenen Prozess der Unterscheidung, der Läuterung und der Reform einzutreten.”1)
Die Forderung Papst Franziskus’ nach einer Kirche, die nicht bei sich bleiben darf, wird freilich schnell gezähmt, denn nichts fürchtet der Geistliche mehr als Weltenschmutz. Es ist schon paradox, dass selbst Bischöfe, die Kirchen niederlegen, trotzdem noch von “Kernorten des Glaubens” sprechen, wie der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck in einem Interview für den Kölner Stadtanzeiger. Auf die Frage, was er sich denn vorstellt, wenn er davon spricht, dass es nicht mehr bei einer Gemeindevorstellung bleiben kann, bei dem man das Modell einer Pfarrei auf einem bestimmten Territorium im Kopf habe, stellt er fest:
“Ich nenne es einmal ‚Kernorte des Glaubens’, eingebettet in große Territorialpfarreien, wo sich dann auch die Leitungsfrage noch einmal ganz anders stellen wird. Sie nur von den Priestern her zu beantworten, wird nicht möglich sein.”2)
Der implizite Widerspruch, Pfarreien mit einem bestimmten Territorium durch große Territorialpfarreien mit “Kernorten des Glaubens” zu ersetzen, wird noch durch die Antwort auf die Frage gesteigert, was der Papst denn meint, wenn er davon spricht, dass die Kirche “an die Ränder” gehen müsse:
“Das Bild vom ‚Rand’ setzt voraus, dass es eine Mitte gibt, ein Zentrum – und dementsprechend eine nach Nähe oder Ferne hierzu gestaffelte Zugehörigkeit. Diese Sicht passt aber nicht mehr. Wenn der Papst im Plural von ‚Rändern’ spricht, wird er damit der wachsenden Pluralität in der Kirche eher gerecht. Vielfalt führt von sich aus näher an die Menschen und ermöglicht neue Kontakte. Die allerdings müssen auch wahrgenommen werden.”3)
Hier bewegt sich Kirche gerade nicht an die Peripherie der Gesellschaft, sondern definiert die Ränder vom eigenen Standpunkt aus. Diese Kirche genügt sich immer noch selbst als Mittelpunkt. Sie liefert sich aber nicht an die Welt aus, sondern bleibt bei sich. Diese Kirche geht eben nicht hin, sondern belässt es bei Einladungen, weshalb der Bischof auch angesichts des zurückgehenden Interesses weiter Teile der Gesellschaft an Gottesdiensten und kirchlichen Dienstleistungen feststellt:
“Ich lade herzlich ein und freue mich über jeden, der kommt.”4)
Zeitzeichen
Wohin die Eingeladenen kommen sollen, wenn Kernorte des Glaubens niedergelegt oder geschlossen werden, bleibt vage. Bloß, dass es nicht nur an den Priestern und Bischöfen hängen kann, die über Jahrhunderte hinweg das Image der Kirche geprägt haben, wird festgestellt. Jetzt sollen es die Laien richten. Man stelle sich vor, dass in Ermangelung von ausgebildeten Medizinern zukünftig Menschen, die einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben, am OP-Tisch stehen. Ähnlich stellen sich die Kirchenführer die Zukunft der Kirche wohl vor. Längst der Welt enthoben hat die Kirche allerdings den nährstoffreichen Boden verloren, auf dem ihre Botschaft gedeihen konnte. Sie hat den schönen Schein gepflegt, ein voll Glorie über das Land schauende Haus mit ergreifendem Kult, der die Seelen in den Himmel erhebt, ohne dass man sich mit Erdendreck die Hände schmutzig machen musste. Dabei bedürfte es gerade jetzt der Kunst, die Zeichen zu erkennen und richtig zu deuten – eine Kunst, auf die Jesus selbst aufmerksam macht:
Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass das Ende der Welt nahe ist. Matthäus 24,32-33
Feige
Der Feigenbaum spielt in der jesuanischen Verkündigung eine besondere Rolle. Es ist nicht nur das Beispiel seiner saftigen Zweige und der treibenden Blätter, das den Sommer ankündigt. Auch andernorts muss der Feigenbaum als mahnendes Beispiel herhalten. So hat Markus in die anfänglichen Ereignisse der letzten Tage Jesu in Jerusalem eine kleine Feigenbaum-Passage eingeflochten, die sich abgewandelt auch bei Matthäus findet. Markus schildert diese Tage als stetes Hin und Her Jesu und seiner Jünger zwischen Betanien und Jerusalem. Betanien liegt von Jerusalem aus gesehen im Südosten hinter dem Ölberg, etwa drei Kilometer von der Stadt entfernt. Hier wohnten nicht nur Maria und Martha (vgl. Lukas 10,38-42; Johannes 11,1-44; 12,1-8). Hierhin kehrt er immer wieder von Jerusalem zurück. Es scheint fast so, als habe er hier nicht nur eine Art Zentrale seines Wirkens in Judäa gehabt, sondern auch – gerade in den letzten Tagen der großen Auseinandersetzung mit seinen Gegnern – einen sicheren Rückzugsort, an dem er sich vor Nachstellungen verbergen konnte. Eine Verhaftung in Jerusalem war auch seinen Gegnern zu gefährlich, wie die Notiz in Markus 11,18 nach der sogenannten Tempelreinigung zeigt:
Die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil das Volk außer sich war vor Staunen über seine Lehre. Markus 11,18
Feigenhausen
In der redaktionellen Dynamik des Markusevangeliums befindet sich Jesus in der Nähe Betaniens bevor er nach Jerusalem einzieht (vgl. Markus 11,1-10). In einer Nebennotiz heißt es dort:
Er zog nach Jerusalem hinein, in den Tempel; nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den Zwölf nach Betanien hinaus. Markus 11,11
Am nächsten Tag wird er nach Jerusalem zurückkehren, um in einem prophetischen Akt, der sogenannten Tempelreinigung, ein Fanal gegen einen oberflächlich gewordenen Tempelkult zu setzen, der Sündenvergebung an ein äußeres Opfer, nicht aber an innere Umkehr bindet (vgl. Markus 11,15-19)5). Vorher aber beschreibt Markus eine fast unscheinbare Begebenheit, die sich auf dem Weg von Betanien nach Jerusalem ereignet:
Als sie am nächsten Tag Betanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter; denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Markus 11,12-14
Möglicherweise ereignet sich diese Begebenheit bei Betfage, das auf dem Weg zwischen Betanien und Jerusalem liegt. Die Ortsbezeichnung geht auf das aramäische בית פגי (gesprochen: Bet Fage), das man auf Deutsch mit “Feigenhausen” wiedergeben könnte6). Etymologisch deutet das auf eine gewisse Präsenz von Feigenbäumen in der Nähe des Ortes hin. Die Verortung der Perikope bei dem Dorf Betfage ist also mehr als bloß spekulativ.
Die Begebenheit ist einigermaßen verstörend. Obwohl es heißt, dass es nicht die Zeit der Feigenernte7) sei, sucht Jesus, der doch gerade gelehrt hat, man solle sich an den Zeichen des Feigenbaumes orientieren, nach Früchten. Trotzdem verflucht er den Feigenbaum, zieht aber weiter nach Jerusalem, setzt dort das Zeichen gegen den Tempelkult und verlässt die Stadt wieder. Der Fortgang der Erzählung legt nahe, dass er wieder nach Betanien zurückkehrt. Tatsächlich erzählt Markus, dass sie am folgenden Tag wieder an dem besagten Feigenbaum vorbeikommen:
Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Markus 11,20-21

Feigenblätter schützen nicht
Der Feigenbaum hatte keine Chance. Es war nicht die Zeit der Ernte – und doch wurde er verflucht. Matthäus steigert die Dramatik noch, wenn er den Feigenbaum unmittelbar nach dem Fluchwort Jesu verdorren lässt (vgl. Matthäus 21,18-19).
Das Verstörende an diesem Geschehen hat die Exegeten immer wieder herausgefordert und verführt, das Dargestellte als Analogie auf Israel auszudeuten. Dazu hat vor allem Deutung Jesu selbst beigetragen, die unmittelbar im Anschluss an das Entdecken des Verdorrens des Feigenbaumes präsentiert wird:
Jesus sagte zu ihnen: Habt Glauben an Gott! Amen, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt: Heb dich empor und stürz dich ins Meer! und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet – glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Markus 11,22-26par
Allein: Von Israel ist hier nicht die Rede, wohl aber vom Glauben an Gott, der auch das scheinbar Unmögliche bewirken kann. Freilich erscheint es absurd, einen Berg versetzen zu wollen. Das Beispiel steht auch nur für die Wirksamkeit des Glaubens. Denn im Wesentlichen geht es um die Überwindung des eigenen Zweifels an der eigenen Wirksamkeit; es geht um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die durch den Glauben und das Gebet aktiviert werden sollen. So beschreibt Jesus ja nicht, dass Gott etwas Erbetenes geben wird, sondern bereits gegeben hat. Die Wendung ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν (gesprochen: elábete, kaì éstai hymîn) beschreibt, dass etwas, das bereits (einmalig)8) empfangen wurde, wirksam wird. Es gibt nichts hinzu. Gott hat bereits das seine durch die Gabe getan, das nun von denen, die beten, auch aktiviert werden muss.
Das Feigenbaumereignis muss von hier aus gelesen werden. Der Text betont ja, dass Jesus Früchte sucht, obwohl keine Erntezeit war. Ihm muss es also um etwas anderes als die bloße Stillung des Hungers gegangen sein. Gleichzeitig betont der Text, dass der Feigenbaum blättertragend war. Man kann sich bildlich vorstellen, wie Jesus in den Baum hineinsteigt und ihn untersucht. Vielleicht – und das ist freilich spekulativ – ist er auch in mehrere Bäume gestiegen, um diesen einen, der hervorgehoben wird, zu finden. Vielleicht hat er diesen einen gesucht, der Anzeichen des Verfalls aufwies, um ihn als Beispiel zu nehmen. Auch das Verdorrte ist immer noch für eine Lehre gut! Ein Feigenblatt mag den Verfall verbergen. Verhindern kann es ihn nicht.
Wenn es sich so zugetragen hat, wäre das Verdorren kein Wunder, der Fluch keine Prophezeiung, sondern eine bloße Feststellung. Dass Jesus es auf diesen Lerneffekt angelegt hat, wird an der beiläufigen Bemerkung deutlich, dass die Jünger die Worte Jesu im Baum hörten (vgl. Markus 11,14). Man stelle sich diese Szenerie bildlich vor: Der im Baum kraxelnde Jesus murmelt so laut seinen Ärger vor sich hin, dass die Jünger ihn hören sollen. Eine wunderbare Pädagogik, die die Seinen schlussendlich zum Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geben soll. Ihnen wird kein Feigenblatt helfen, wenn sie nicht auf die eigenen Fähigkeiten, die Gott ihnen doch schon längst gegeben hat, vertrauen.
Kronenkosmetik
Die eigenen Fähigkeiten spielen in der Kirche kaum mehr eine Rolle. Bestenfalls redet man von Charismenorientierung, ohne dass man sich Rechenschaft darüber ablegt, was Charismen denn überhaupt sind. So beschreibt eine Mitarbeiterin des Bochumer Zentrums für angewandte Pastoralforschung (ZAP) in einem Gespräch, das am 5. März 2018 zwischen dem Autor dieses Beitrages und dem Team des ZAP als Reprise auf den Dei Verbum-Beitrag “Zieht die Schuhe an” stattgefunden hat, das Scheitern des von ihr betreuten Projektes im Erzbistum Berlin, bei dem offenbar wurde, dass Priester und Laien etwas völlig anderes unter Charismen verstehen. Die innerkirchliche Sprachunfähigkeit, die darin begründet ist, dass der Begriff “Charisma” trotz seines inflationären Gebrauchs offenkundig nicht wirklich mit Inhalt gefüllt ist. An anderer Stelle wird im ZAP dafür an der Frage geforscht, wie kirchliche Leitung von morgen aussehen müsste – kurz: über welche Fähigkeiten Bischöfe verfügen müssten. Das ist eine wahrhaft berechtigte Frage, die allerdings ebenso an der normativen Kraft des Faktischen scheitern dürfte, wie der im Anschluss an eine ebenfalls vom ZAP erstellten und vom Bistum Essen in Auftrag gegebenen Kirchenaustrittsstudie9) geforderte Imagewechsel der Kirche10).
Bei all dem bleibt freilich die Frage, ob das nicht nur kosmetische Eingriffe sind. Zum einen kann man wohl kaum diejenigen, die für das Entstehen des aktuellen Kirchenimages verantwortlich sind, austauschen, verfügen viele von ihnen doch aufgrund einer Weihe über einen Character indelibilis – ein unauslöschliches Prägemal -, was zum anderen vor die Frage führt, mit welchem Personal denn ein Imagewechsel herbeigeführt werden soll. Das betrifft auch die Frage nach den Fähigkeiten, um nicht Neudeutsch “Skills” zusagen, die ein Bischof haben muss. Bisher mussten Bischöfe sich jedenfalls nicht in Assessment-Centern für die neue Aufgabe bewerben, was ja auch dem gängigen Verständnis von “Berufung” zuwiderläuft.
Die Zahl der ekklesialen Feigenblätter ist wahrhaft groß. In der Kirche wird immer wieder von Charismen, Berufung, Ehrenamt und Gemeinschaft geredet – alles Begriffe, von denen man glaubt, es sei doch klar, was gemeint ist. Aber dieser Glaube versetzt keine Berge, schon gar nicht interessiert sich die Welt für diese entweltlichten Themen. Das alles ist Kosmetik an der Baumkrone, die schon lange keine Früchte, dafür viele Feigenblätter trägt. Wer diese Zeichen lesen kann, erkennt, dass die Zeit für eine grundlegende Therapie reif ist.
Wurzelbehandlung
Wenn ein Baum keine Früchte mehr trägt, liegt das Problem nicht selten an der Wurzel. Jesus selbst scheint viel vom Feigenbaum verstanden zu haben – zu viel, als dass es eines Fluchwunders bedurft hätte. Seine Beobachtungsgabe hat ihn nicht nur den einen Baum, der zur Mahnung werden sollte, finden lassen. Er kennt auch eine Therapie, die er in einem Gleichnis empfiehlt:
Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt; und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte; wenn nicht, dann lass ihn umhauen! Lukas 13,6-9
Auch der fruchtlose Baum hat offenkundig noch eine Chance. In ihm schlummern noch Fähigkeiten. Um sie zu aktivieren, muss man an die Wurzeln gehen, sie bearbeiten, in den Erdendreck hineinwirken, sich die Hände schmutzig machen, im Schweiße des Angesichtes das Unterste nach Oben holen, die Wurzeln belüften, dass sie sich neu bewuchern lassen mit dem Pilz, der ihnen Nahrung gibt.
Die Kirche ist reif für eine Wurzelbehandlung. Sie muss in die Welt. Sie muss sich schmutzig machen. Das geschieht nicht mit schönen Projekten, die man sich Feigenblättern gleich, wie eine Krone auf das Haupt setzt. Die Scham der Kirche liegt trotzdem bloß, wenn sie sich nicht endlich auf das besinnt, was sie schon längst empfangen hat.

Raus aus dem Paradies!
Als der Mensch das Paradies verlassen musste, nahm Gott ihm die Feigenblätter, mit denen er dürftig seine Scham verbarg, und machte ihm Gewänder von Fell (vgl. Genesis 3,21). So ausgerüstet schickte er die Menschen in Welt und Leben. Diesen Weg muss die Kirche nun gehen. Ihr ist weder Pracht noch Kult anvertraut. Das kam später. Der Auftrag und damit die Befähigung, die den Jüngerinnen und Jüngern Jesu aufgetragen ist, beschreibt Markus so:
Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Markus 16,15-16
Die Fähigkeit des Hinausgehens und des Verkündens – das ist das, was die Kirche tun soll. Alles andere wird dann von selbst geschehen. Es geht nicht ums Einladen und darum, dass Menschen kommen. Es geht nicht ums Warten, sondern um das aktive Tun: Geht in die Welt und verkündet! Macht euch die Hände schmutzig, redet euch den Mund wund, streitet mit den Vertretern der Welt um die Wahrheit.
Kein System ändert man mit ein wenig Kosmetik. Revolutionen von oben gibt es nur in der Theorie. Wer Änderung will, muss unten, vor allem bei sich selbst anfangen – es ist der einzige Faktor, der aktiv beeinflussbar ist. Deshalb braucht die Kirche keinen Imagewechsel. Sie muss vielmehr zurück zu den Wurzeln: der Verkündigung der frohen Botschaft in der Welt und an alle Geschöpfe. Es gibt in der Kirche genug Freiräume, wo das jetzt schon möglich ist. Wo aber sind diejenigen, die auf ihre längst erhaltenen Fähigkeiten vertrauen? Wo sind die theologischen Institute, die solche Fähigkeiten fördern? Wo sind die Redner, Streiterinnen und mit Gott Begeisterten, die die Welt in Atem halten? Die Zeit der Sauertöpfe ist vorbei, Sauerteig ist angesagt! Zieht die Schuhe an! Verlasst die Stuhlkreise! Wer jetzt noch die Hände in Unschuld wäscht, ist kein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Weiße Westen müssen mit dem Blut der Leidenschaft gewaschen sein – sonst bekommen sie Stockflecken. Die Zeit ist überreif, dass es an die Wurzeln geht! Es ist Wurzelzeit!
Bildnachweis
Titelbild: Baum-Wald-Wurzel (Tookapic) – Quelle: Pexels – lizenziert als CCO.
Bild 1: Toter Baum (Lutz Schröer) – Quelle: flickr – lizenziert als CC BY-NC 2.0.
Bild 2: Kath 2:30-Cartoon “Da ist noch Leben drin” (Knut “kumi” Junker/Katholische Citykirche Wuppertal) – alle Rechte vorbehalten.
Einzelnachweis
| 1. | ↑ | Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 2013, Nr. 30. |
| 2. | ↑ | Joachim Frank, Bischof Franz-Josef Overbeck im Interview: “Ich freue mich über jeden, der kommt”, Kölner Stadtanzeiger online, 9.3.2018, Quelle: https://www.ksta.de/politik/bischof-franz-josef-overbeck-im-interview–ich-freue-mich-ueber-jeden–der-kommt–29845672 [Stand: 10. März 2018]. |
| 3. | ↑ | Joachim Frank, Bischof Franz-Josef Overbeck im Interview: “Ich freue mich über jeden, der kommt”, Kölner Stadtanzeiger online, 9.3.2018, Quelle: https://www.ksta.de/politik/bischof-franz-josef-overbeck-im-interview–ich-freue-mich-ueber-jeden–der-kommt–29845672 [Stand: 10. März 2018]. |
| 4. | ↑ | Joachim Frank, Bischof Franz-Josef Overbeck im Interview: “Ich freue mich über jeden, der kommt”, Kölner Stadtanzeiger online, 9.3.2018, Quelle: https://www.ksta.de/politik/bischof-franz-josef-overbeck-im-interview–ich-freue-mich-ueber-jeden–der-kommt–29845672 [Stand: 10. März 2018]. |
| 5. | ↑ | Die in Markus 11,15-16 erwähnten Händler und Geldwechsler waren im Wesentlichen für den Betrieb des Tempelkultes notwendig Die Händler verkauften die für den Kult notwendigen Opfertieren (Johannes 2,14), während die Geldwechsler für den Umtausch entsprechender Währungen in die Tempelwährung und damit auch für den Einzug der Tempelsteuer, von der die Tempelbediensteten lebten, zuständig waren. Es ist gerade die Äußerlichkeit des Kultes, gegen die Jesus aufbegehrt. |
| 6. | ↑ | Wortwörtlich meint פג (gesprochen: Fag) die unreife Frühfeige. |
| 7. | ↑ | Feigenbäume reifen dreimal jährlich: Im Februar/März, im Mai/Juni und im August/September. Mehr zur Feigenbaumernte findet sich in dem Audiobeitrag “ZuMUTung – BeGEISTerung – BeRUFung – BeWEGung. Den Religionsunterricht, meine Schüler und mich selbst neu in den Blick nehmen”, den Dr. Werner Kleine am 28.2.2018 zum Auftakt des religionspädagogischen Förderschultages im Priesterseminar Köln hielt, ab Minute 10:29: https://soundcloud.com/logisch-1/zumutung-begeisterung-berufung-bewegung#t=10:29. |
| 8. | ↑ | Ἐλάβετε beschreibt als Aorist einen einmaligen Zeitpunkt des Empfanges. |
| 9. | ↑ | Markus Etscheid-Stams, Regina Laudage-Kleeberg, Thomas Rünker, Kirchenaustritt – oder nicht?. Wie Kirche sich verändern muss, Freiburg i. Br. 2018. |
| 10. | ↑ | So zeigt sich etwa der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer mit Blick auf die Studie über das “miserable” Kirchenimage überrascht und stellt fest: “Da haben wir noch ziemlich viel Luft nach oben”. (Quelle: http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/generalvikar-miserables-kirchenimage-uberraschend [Stand: 10. März 2018]. |