den Artikel
Am Ende der Flucht wartet keine Heimat. Das Paradies ist für immer verloren. Selbst wer zurückkehrt, wird erkennen müssen, dass nichts mehr ist, wie es war. Das gilt für die geographischen Fluchtbewegungen genauso wie für die intellektuellen. Während erstere aber als Vertreibung durch Krieg, Verfolgung und reales Leid fremdbestimmt sind, sind letztere meist selbstgewählt. Beides sind Fluchten, aber unterschiedlich verursacht. Vertreibung im ersten Sinn geht meist mit tiefer Klage einher, die Flucht in das intellektuelle Exil wird meist von Jammer über das eigene Schicksal begleitet1).
Ausgeträumte Wirklichkeiten
Im Februar 2016 erregte der Münsteraner Pfarrer Thomas Frings große Aufmerksamkeit, als er in einem Facebook-Posting vom 14. Februar 20162) seine Entscheidung veröffentlichte und begründete, sich aus der gemeindlichen Pastoral zu verabschieden und in ein niederländisches Kloster zurückzuziehen. Der unter dem Titel „?Kurskorrektur!“ stehende Text beschreibt unverstellt die Situation, der sich wohl alle in der westeuropäischen Gesellschaft pastoral Handelnden ausgesetzt sehen. Mit Blick auf seine eigene Motivation stellt er fest:
„Bin ich Priester geworden mit der Erwartung, dass Glaube und Kirche wieder relevanter werden? Mit 27 hatte ich zumindest Hoffnung! Aber unter veränderten Koordinaten habe auch ich mich verändert. Ich habe den Glauben daran verloren, dass sich der Weg, auf dem ich als Gemeindepfarrer mit Freude und Engagement gegangen bin, ein zukunftsweisender ist. Bestenfalls vermag er eine leichte Bremse auf dem Weg des Bedeutungsverlustes zu sein.“3)
Die Entscheidung von Thomas Frings hat zu einer intensiven Diskussion über das Selbstverständnis des sogenannten pastoralen Dienstes, aber auch der Gemeinden selbst geführt. Während die einen sich wie Thomas Frings gegen eine Kirche als Dienstleisterin verwahren, sehen andere gerade hierin den eigentlichen Auftrag der Kirche. Gleichwohl stellt etwa der Bochumer Pastoraltheologe Matthias Sellmann fest:
„Christliche Gemeinde [hat] auch nur wenig mit Freundschaft, Heimat, Kameradschaft und Zuneigung zu tun. Wo Gemeinden ein ‚Club’ werden, bleiben sie wertvoll – aber es sind sozusagen Autos, die in der Garage bleiben. Sie erbringen nicht mehr die Dienstleistung, für die sie gebaut wurden.“4)
Gemeindliche Wirklichkeit und die Realität des pastoralen Dienstes hängen also wohl eng zusammen. Die Gemeinde hat keinen Zweck in sich. Sie hat einen Auftrag. Gemeindliche Gemeinschaft ist nicht das Ziel pastoralen Handelns, sondern dessen Methode. Demgegenüber träumt Thomas Frings aber von einer goldenen Zeit des Anfangs:
„Seit der Gemeinschaft der Apostel hat es nie eine ideale Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu gegeben. Es ist jedoch ein Unterschied, ob diese Gemeinschaft sich ausbreitet, Gemeinden gründet, Kirchen baut und Gesellschaft beeinflusst oder ob man Zeit seines Lebens einen Konsolidierungsprozess erfährt, in dem gleichzeitig die Servicementalität wächst. Ich erlebe einen ununterbrochenen Rückzug.“5)
Bleibt nur zu fragen, ob es diese Zeit einer idealen Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu überhaupt gegeben hat.

Goldene Zeiten?
Bereits Lukas, der neben dem Evangelium auch die Apostelgeschichte verfasst hat, beschwört wenige Jahrzehnte6) nach den Anfängen der Kirche die goldenen Zeiten der Vergangenheit. Etwa um das Jahr 80 n. Chr. beschreibt er in der Apostelgeschichte die Entstehung der ersten Gemeinde. Sie hatte sich nach der sogenannten Pfingstpredigt des Petrus gegründet. Nach Lukas hatten sich aufgrund dieser Predigt dreitausend Menschen taufen lassen (vgl. Apostelgeschichte 2,41). Das ist die Geburtsstunde der Kirche, die sich dadurch definiert, dass die ihr Angehörenden
an der Lehre der Apostel fest[hielten] und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten (vgl. Apostelgeschichte 2,42).
An diese wohl älteste Kirchendefinition (apostolische Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete) schließt Lukas eine Beschreibung des Lebens der jungen Gemeinde an:
Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.
Das müssen wahrhaft goldene Zeiten gewesen sein. In einer Art frühchristlichen Kommunismus gab es kein „Mein“ und „Dein“ mehr. Einmütigkeit (ὁμοθυμαδόν – gesprochen: homothymadón) war ihr Kennzeichen. Und der Erfolg war eindeutig, fügte der Herr doch täglich (καθ᾽ ἡμέραν – gesprochen: kath’ hemeran) ihrer Gemeinschaft neue Mitglieder hinzu.
Zuckerbrot und Peitsche
Tatsächlich beschwört Lukas hier wohl mit Blick auf die reale Gemeinde, für die er die Apostelgeschichte ursprünglich verfasst hat, einen idealen Urzustand, weil gerade die gegenwärtige Situation der von ihm intendierten Gemeinde sich davon unterschieden haben dürfte. Nicht umsonst berichtet er deshalb wenige Kapitel später von dem Betrug eines gewissen Hananias und seiner Frau Saphira, die den idealen Zustand des gemeindlichen Gemeinbesitzes zerstörten, indem sie lediglich einen Teil des Erlöses aus einem Grundstücksverkauf den Aposteln übergaben (vgl. hierzu Apostelgeschichte 5,1-11). Die Strafe, die die beiden Eigennützigen, deren Betrug in der Übervorteilung der gemeindlichen Gemeinschaft besteht, ist drastisch:
Da sagte Petrus zu ihr [d.i. Saphira, WK]: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür; auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann.
Textstrategisch bezeichnend ist vor allem aber die von Lukas geschilderte Reaktion der Gemeinde:
Da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten.

Pastorale Utopien
Lukas hält seiner Gemeinde Verheißung und Verdammnis vor Augen. Das macht nur Sinn, wenn die Gemeinde sich gerade nicht in einem solchen idealen Zustand befand. Das idealisierte Bild der Urgemeinde dürfte dabei wohl kaum den historischen Gegebenheiten entsprochen haben. Das Neue Testament ist voll von Aufrufen und Mahnungen zur Rückbesinnung auf ein gemeindliches Ideal. Der Autor des Hebräerbriefes etwa mahnt:
Darüber hätten wir noch viel zu sagen; es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt; Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen; er ist ja ein unmündiges Kind; feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden.
Das Schreiben an die Hebräer entsteht in etwa dem gleichen Zeitraum wie die lukanischen Schriften. Die Gemeinde, die hier angesprochen wird, müsste weiter sein, als sie tatsächlich ist. Aber sie ist müde geworden, was sich nicht zuletzt in nachlassendem Besuch der gemeindlichen Zusammenkünfte auswirkt. Nicht ohne Grund mahnt der Autor des Schreibens an die Hebräer:
Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht.
Aber schon viel früher müssen sich die Gemeindegründer immer wieder motivierend betätigen. Paulus etwa, der in Person für die frühesten Gründungen heidenchristlicher Gemeinden wenige Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi verantwortlich ist, muss sich nicht nur immer wieder mit innergemeindlichen Gegnern auseinandersetzen, wie beispielsweise der Galaterbrief zeigt:
Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Doch es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Wer euch aber ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal: Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ihr angenommen habt, der sei verflucht.
Auch das Verhältnis der engeren Mitarbeiter untereinander war wohl nicht konfliktfrei oder führte zumindest in den Gemeinden selbst zu Parteiungen und Spaltungen. Das ist zum Beispiel dem 1. Korintherbrief zu entnehmen, wenn Paulus die Gemeinde zu einer Einheit mahnt, die sie wohl längst schon verloren hat:
Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn: Seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines Sinnes und einer Meinung Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloë berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt: Ich halte zu Paulus – ich zu Apollos – ich zu Kephas – ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden?
Vorprogrammiertes Scheitern
Paulus war vor allem Verkünder. Er vollzieht den Auftrag Jesu, wie er im Markusevangelium bezeugt ist. Der Auferstandene gibt dort seinen Jünger den Auftrag zur Verkündigung:
Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!
Verkündigung ist der Auftrag, nicht Gemeindegründung und Bekehrungspastoral. Verkündigung ist das, worum es geht – nicht mehr und nicht weniger. Das aber mit ganzem Einsatz, an allen Orten und zu allen!
An einem solchen Anspruch kann man nur scheitern.
Vergrößern

Undankbarkeit schützt vor Heilung nicht
Selbst Jesus ist die Erfahrung scheinbarer Erfolglosigkeit nicht erspart geblieben, sofern man Erfolglosigkeit an der prosperierenden Zahl der Nachfolger bemisst. Lukas, der seiner Gemeinde das Ideal der goldenen Ära der Urgemeinde vor Augen hielt, überliefert in seinem Evangelium die Heilung von zehn Aussätzigen:
Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen.
Das ist eine bemerkenswert niedrige Quote, die Jesus da einfährt. Nur 10% der Geheilten kehren voll Dankbarkeit zu ihm zurück. Die anderen 90% ziehen einfach geheilt ihrer Wege – ohne Wort des Dankes und ohne Nachfolge. Sie bleiben aber geheilt. Der eine empfängt letztlich mehr als die neun anderen. Seine Umkehr bewirkt die volle Gemeinschaft mit Jesus. Den anderen Neun scheint nichtsdestotrotz nichts zu fehlen.
Die Effizienz der Verschwendung
Von Misserfolg kann eigentlich keine Rede sein. Eher von Selbstlosigkeit. Es geht Jesus um das Heil der Menschen. Die Menschen sind und bleiben auf dem Weg ihres Lebens. Viele Begegnungen der Menschen mit Jesus, die in den Evangelien überliefert sind, sind eher kurz gewesen. Minutenkontakte, in denen es um das Ganze des Lebens geht. Im Augenblick der Begegnung wird ein Samenkorn gepflanzt, das auf je unterschiedliche Weise Frucht bringen kann. Manches bleibt einfach bei dieser Begegnung – nichts wird weiter geschehen. Manches keimt kurz auf, wächst aber nicht weiter. Manches aber bringt überreiche Frucht. Alles ist möglich, nichts wird ausgelassen. Jesus scheint die Begegnungen nach einem eigenen Effizienzkriterium zu gestalten: Der Effizienz der Verschwendung. Das Heil gibt es immer vorbehaltlos, unverdient und umsonst – ohne Hintergedanken, ganz und gar. Die Auswirkungen des Heils sind aber je unterschiedlich. Einige ziehen einfach geheilt ihrer Wege, andere treten dankbar in die Nachfolge Jesu ein. Jene bleiben geheilt, diese werden selbst zu Verkündern des Heils. Niemandem wird etwas genommen, einige erhalten noch dazu und bringen reiche Frucht. Das ist der tiefere Sinn des Sämannsgleichnisses, wie es etwa Markus erzählt:
Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört! Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht; die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre!

Wer verkündet, der muss fühlen
Das Gleichnis spricht von einer tiefen Erfolgsgewissheit. Die Verkündigung wird Erfolg haben. Aber sie ist unberechenbar. Damit sie erfolgreich ist, muss sie verschwenderisch sein. Wer hier nur auf den vordergründigen Schein des zahlenmäßig Erfassbaren schaut, dem wird die Frustration gewiss sein. Dabei ist Jesus selbst der Misserfolg nicht fremd. Nach der Euphorie anfänglicher Erfolge seines Wirkens in Galiläa, den die Exegeten auch als „galiläischen Frühling“7) bezeichnen, wenden sich die ersten enttäuscht von ihm ab, weil ihnen seine Verkündigung dann doch zu weit geht:
Viele Jünger [zogen sich] zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen?
Alles umsonst
Das ist genau die Frage, die sich pastoral Handelnde auch in den gegenwärtigen Zeiten stellen müssen. Der Misserfolg ist mit Händen greifbar. Es scheint nichts mehr zu wachsen. Genau diese Situation ist Jesus von Nazareth aber eben nicht fremd. Es ist das Schicksal der Verkünder des Wortes Gottes, dass sie genau diese Erfahrung machen. Deshalb gilt die Frage Jesu zu allen Zeiten auch ihnen:
Wollt auch ihr weggehen?
Verkünderin ist man nicht um ihrer selbst willen. Prediger ist man nicht um seiner selbst willen. Priester und Bischof ist man nie um seiner selbst willen. Alle reden vom Dienst, aber keiner will Diener sein. Wer beantwortet die Frage Jesu nach dem Weggehen heute so wie weiland Petrus selbst:
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.
Das ist doch die viel beschworene Seligkeit: Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Heiligen Gottes. Wer ihm nachfolgt, kann dies nur tun, wenn er zu den Menschen geht, kostenlos, ohne Hintergedanken, umsonst. Nur so kann das Wort Gottes reiche Frucht bringen, wenn jedes pastorale Handeln von Grund auf umsonst ist.
Das Jona-Syndrom
Der Prophet Jona steht für die vielen, die vor dem eigentlichen Auftrag Gottes fliehen möchten. Doch der Auftrag holt sie ein. Es nutzt eben nichts, vor dem Allgegenwärtigen Reißaus zu nehmen. In der Eitelkeit des ungewollt Berufenen aber erhofft sich der Prophet letztlich doch noch das Einfahren seines persönlichen Erfolges: Er möchte die Vernichtung der Sünder miterleben, um sich selbst im Glanze selbstgenommener Heiligkeit zu aalen. Ein kleiner Wurm schließlich macht das Ansinnen zunichte und lässt den erbärmlichen Propheten in Jammerei ausbrechen. Das Jona-Syndrom hat auch die Kirche des Westens befallen. Und so suchen manche ihr Heil in der Flucht vor einer Wirklichkeit, die sich partout nicht in die eigenen Träume verwandeln lassen möchte. Echte Verkündigung ist eben anstrengend, Pastoral ist Arbeit.
Jesus sagte zu allen: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Er hat nie versprochen, dass Nachfolgen einfach sei. Im Gegenteil.
Bildnachweis
Titelbild: Flüchtige Erscheinung II (Bernd Vonau / photocase.de) – Quelle: Photocase – lizenziert als Photocase Basislizenz
Bild 1: Auf der Mauer (french_03 / photocase.de) – Quelle: Photocase – lizenziert als Photocase Basislizenz
Bild 2: Rauchzeichen (rachel / photocase.de) – Quelle: Photocase – lizenziert als photocase Basislizenz
Bild 3: Die Heilung der zehn Aussätzigen – Codex Aureus Epternacensis (1030-1050 n. Chr.) – lizenziert als gemeinfrei
Bild 4: Mosaik in Ostia Antica: „Felicissimus ex voto“ (Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons) – Quelle: Wikicommons – lizenziert als CC BY 2.5
Einzelnachweis
| 1. | ↑ | Zur Unterscheidung von Jammer und Klage siehe den Beitrag der BR 2-Sendung „Radio Wissen“ vom 10.2.2016 „Vom Sinn des Klagens. Philosophische Betrachtungen“ – Manuskript unter http://www.br.de/radio/bayern2/service/manuskripte/manuskripte-radiowissen-3150.html [Stand: 28. Februar 2016], Audio unter http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/klagen-jammern-philosophie-100.html [Stand: 28. Februar 2016]. Zur Theologie der Klage siehe auch das Video von Till Magnus Steiner „Darf man Gott anklagen“ unter https://www.youtube.com/watch?v=qT5BunHICDw [Stand: 29. Februar 2016]. |
| 2. | ↑ | Vgl. hierzu Thomas Frings, ?Kurskorrektur!, https://www.facebook.com/kreuzkirche.muenster/posts/916981931710887 [Stand: 28. Februar 2016]. |
| 3. | ↑ | Ebd. |
| 4. | ↑ | http://kirchensite.de/aktuelles/news-aktuelles/datum/2016/02/25/pastoraltheologe-gemeinden-nicht-experimentierfreudig/ [Stand: 28. Februar 2016]. |
| 5. | ↑ | Thomas Frings, ?Kurskorrektur!, a.a.O. |
| 6. | ↑ | Die große Mehrheit der Exegeten nimmt an, dass beide Schriften zwischen 70 und 90 n. Chr., wahrscheinlich um 80 n. Chr. abgefasst worden sind. |
| 7. | ↑ | Zum Begriff des “galiläischen Frühlings” siehe etwa Franz Mußner, Methodologie der Frage nach dem historische Jesus, in: ders., Jesus von Nazareth im Umfeld Israels und der Urkirche. Gesammelte Aufsätze (hrsg. von Michael Theobald), WUNT 111, Tübingen 1999, S. 13-42, hier S. 14 |
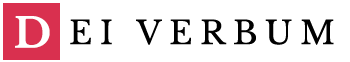





Vielen Dank für diesen ermutigenden Beitrag. Es geht ja wirklich nicht um persönliche Erfolge in der Pastoral. Manchmal ist unsere (Verkündigungs-)arbeit scheinbar erfolglos – aber trotzdem wirksam (siehe das Gleichnis von den 10 Aussätzigen).
Die ermutigenden Gedanken nehme ich gern und dankbar zur Kenntnis. Was bedeuten diese Ausführungen aber für unsere Pastoral, die sich zu einem erheblichen Teil in unseren Ortsgemeinden konkretisiert. Einfach ein WeiterSo? Das, meine ich, ist die Frage von Thomas Frings, nicht der Traum von einer heilen Kirche des Anfangs und auch nicht die Flucht. Wer frustiert ist, träumt nicht mehr. Wohl aber kann ein Innehalten und grundsätzliches Hinterfragen manchmal lebensnotwendig sein und neue Orientierung geben, für den Einzelnen wie für die Kirche insgesamt.
Lieber Herr Hubert, vielen Dank für Ihren Kommentar. Die Frage hinter allem ist doch die nach dem Ziel. Thomas Frings, der im Übrigen im September 2015 unser Projekt “Katholische Citykirche Wuppertal” besucht hat und mit dem ich damals ins Gespräch kommen konnte, geht m.E. – und das sage ich auch gerade nach dem Gespräch – von einer Denkvoraussetzung aus, die in der Gemeindebildung das Ziel allen pastoralen Handelns sieht. Genau das scheint mir aber das Problem zu sein. Er schreibt es ja selbst in seinem Facebook-Posting, wenn er auf den idealen Zustand der apostolischen Zeit verweist, den es so aber eben nie gegeben hat. Wer solche Ideale, die eben historisch nie existent gewesen sind, einzuholen versucht, muss an sich selbst scheitern.Dahinter steckt aber noch ein anderes Dilemma – nämlich das der Selbstzentrierung der pastoral Handelnden. Erfolg oder Misserfolg werden als persönliches Scheitern begriffen. Aber geht es überhaupt darum? Bei Thomas Frings habe ich genau diesen Eindruck: Die Menschen goutieren sein Bemühen nicht genug. Damit aber steht er selbst im Mittelpunkt. Der biblische Auftrag ist aber gerade ein anderer, wie ich in meinem Beitrag zeige.Von daher tue ich mich schwer mit der Sichtweise, dass hier jemand auf einen anhaltenden Missstand aufmerksam gemacht hat. Die Welt ist wie sie ist. Die Botschaft in diese Welt zu tragen, ist der Auftrag der Verkünderinnen und Verkünder. Wer da auf Lob wartet oder auf den Lohn zahlenmäßigen Erfolgs geht von vorneherein von falschen Voraussetzungen aus und landet eben in der Frustration. Die Reaktion von Thomas Frings scheint mir daher weniger ein Fanal für die Kirche zu sein, sondern ein Symptom vieler pastoral Handelnder, die vielleicht die Perspektive zu sehr in sich selbst verlegen. Verkünderinnen und Verkünder sind eben Botschafter, nicht die Botschaft selbst. In diesem Sinne versteht sich auch meine Einlassung: “Alle reden vom Dienst aber niemand will Diener sein.”Ich verstehe Ihren Kommentar durchaus in die gleiche Richtung. Meine Antwort versteht sich daher eher als Ergänzung.Ihr W. Kleine
Lieber Herr Dr. Kleine,
auch wenn ich hier keine öffentliche Diskussion weiterführen oder verteidigen möchte, was Thomas Frings denn nun genau gesagt oder gemeint hat, danke ich Ihnen für ihre ausführliche Antwort. “Alle reden vom Dienst, aber niemand will Diener sein.” Auch wenn diese Formulierung etwas plakativ erscheint, damit ist ein wesentlicher Kern benannt. Das gilt allerdings für alle in der Gemeinde Jesu. “Die Gemeinde ist kein Selbstzweck, sondern hat einen Auftrag”, so oder ähnlich habe ich es in ihrem Beitrag gelesen. Das ist zweifellos richtig, und meine Frage wäre, ob das tatsächlich genügend im Bewußtsein aller in der Gemeinde angekommen ist. Hier stehen viele Seelsorger doch mit einer großen Ratlosigkeit. Und auch wenn ich persönlich vielleicht in einer anderen Situation bin, ich kann gut verstehen, dass Seelsorger ausbrennen und keine Perspektive mehr sehen, wenn sie von einem Großteil ihrer Gemeindemitglieder hauptsächlich als Dienstleister wahrgenommen werden, für ein gutes Klima oder eine schöne Feier. Wo bleibt dann unser gemeinsamer Auftrag oder unser gemeinsamer Dienst für die Welt? Das ist eine Frage, vor der viele stehen und da geht es noch gar nicht um Erfolg oder Lob, auch nicht um ein Idealbild, sondern um ein Selbstverständnis von Kirche.
Lieber Herr Hubert, ich wollte Sie auch gar nicht in die Situation einer Verteidigung bringen, weil ich Ihnen ja prinzipiell zustimme. Natürlich gibt es Seelsorger, die in ihrem Dienst ausbrennen. Das ist ja nicht nur ein Phänomen bei den Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Burnout als Krankheit – nicht als vorübergehende Phase (da muss man, denke ich, auch noch einmal genauer hinschauen) – bedarf der heilenden Zuwendung udn Therapie. Aber davon ist bei Thomas Frings ja gar nicht die Rede (wie auch sein jüngstes Interview im Domradio zeigt – https://www.domradio.de/radio/sendungen/kopfhoerer/mein-leben-war-noch-nie-so-spannend-wie-jetzt-der-priester-thomas-frings). Allein die Aussage, dass sein Leben noch nie so spannend wie jetzt sei, spricht doch deutlich gegen ein Ausgebranntsein. Und genau das ist mein Problem mit seinem Entschluss. Zu den persönlichen Motiven kann und will ich gar nichts sagen. Das ist seine ureigene Sache. Andererseits macht er ihn ja in einer sehr exponierten Weise öffentlich und findet genau den Zuspruch, dass kirchliche Mitarbeiter vor allem als Dienstleister wahrgenommen werden. Ja, was sollen sie denn sonst sein, wenn sie für sich in Anspruch nehmen einen “Dienst” auszuüben. Da setzt mein Denken in diesem Beitrag an: Wird hier nicht von vorneherein eine falsche Eigenperspektive eingenommen? Sind nicht die Erwartungen an sich an den Menschen vorbei formuliert? Wo bleibt die aktive und offensive Verkündigung in die Zeit von heute – ohne dass an dem, was verkündet werden soll, Abstriche gemacht werden? Ich glaube, dass genau hier das Problem liegt: Es gibt eine Erwartungshaltung an die Menschen, die dem eigenen Bild entsprechen sollen, es aber nicht tun. Die Ratlosigkeit kann ich da nur bedingt verstehen – gerade angesichts der in meinem Beitrag zitierten biblischen Texte, die doch deutlich machen, dass der allein sichtbare Erfolg, den alle so gerne hätten, genau nicht das ist, worum es geht. Verkündigung ist das eigentliche Selbstverständnis der Kirche – das ist die Botschaft des Neuen Testamentes, eben nicht Gemeindegründung. Es ist eben, wie mit dem Aussäen: Man muss es immer wieder tun. Seelsorger sind Sämanner und -frauen – das hört nicht auf … Warum sollte man aufhören zu verkünden? Lieber Herr Hubert, das verstehe ich gar nicht als Gegenrede. Im Gegenteil! Ich glaube nur, dass viele den Blick zu sehr auf die eigenen Bedürfnisse wenden. Damit aber würden sie genau das tun, was sie den Menschen vorwerfen. Ich hoffe sehr, dass ich hier im Irrtum bin … zweifle aber leider daran.