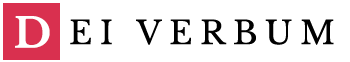den Artikel
Da ist kein Haus voll Glorie mehr, das weit über alles Land schaut. Die Erinnerung an Zeiten prunkvoller Liturgien, prächtiger Prozessionen und einer öffentlichen Relevanz sind Geschichte. Symptomatisch dafür ist ein besonderer Inzidenzwert. Gehörten noch vor einigen Jahren Theologinnen und Theologen oder andere Leute aus der Kirche zur Standardbesetzung von Talkshows, sei es, dass man für den Part der Mitmenschlichkeit stand, sei es, dass man pointiert in moralisch umstrittenen Themen Stellung beziehen sollte und dabei nicht selten die Rolle der weisen Alten, deren Überzeugungen nur schwer mit modernen Befindlichkeiten zu arrangieren sind, innehatte. Wie auch immer: Die Kirche war präsent und konnte selbst bei konfliktiven Themen, wo sie mit ihrer Lehre oft nicht mehrheitsfähig war, doch einflussreich in den Debatten wirken. Jetzt aber sucht man Kirchenleute vergeblich im öffentlichen Diskurs. Wenn überhaupt werden sie als skurrile Vertreterinnen und Vertreter eingeladen, die als Überlebende längst vergangener Zeiten museal bestaunt werden, wie die Dinosaurier in Michael Crichtons Jurassic Park.
Milieusensible Selbstverliebtheiten
Während die Öffentlichkeit die Stellungnahmen kirchlicher Vertreterinnen und Vertreter bestenfalls noch zur Kenntnis nimmt, ist die innerkirchliche Sichtweise eine völlig andere. Da wird um die Zukunft gerungen, was das Zeug hält. Sicher nimmt man den öffentlichen Relevanzverlust wahr. Die Diskussionen aber kreisen um die immer gleichen Themen: Der Pflichtzölibat muss fallen, Frauen sollen endlich geweiht werden und das Volk Gottes soll endlich mitbestimmen dürfen. Nur um das klarzustellen: All diese Themen sind durchaus von Bedeutung. Allerdings gibt es in den vergangenen Jahrzehnten in der Sache überhaupt keinen Fortschritt. Im Gegenteil: Selbst beim synodalen Weg, der als prächtiges Forum innerkirchlicher Diskursfähigkeit gestartet ist und durchaus veritable theologische Akzente setzt, wird damit leben müssen, dass den vielen guten Papieren kaum praktische Konsequenzen folgen werden. Allein die satzgemäßen Prozeduren für die Abstimmungen geben einer klerikal-episkopalen Minderheit eine Vetomacht an die Hand1), die jede Forderung nach relevanter Mitbestimmung von Laien milde weglächelt. Allerdings erstaunt es schon, dass manch ein Synodendelegierter angesichts des offensiven Fortschreitens theologischen Denkens wie ein aufgescheuchter Pfau aus dem Busch springt, die Federn zu einem Rad schlägt und lauthals Protest anmeldet, als stünde ein faktisches Schisma bevor2). Dass dem wohl nicht so ist, haben die progressiv denkenden Theologinnen und Theologen in den letzten Jahren wohl immer wieder unter Beweis gestellt. Trotz aller Kritik haben sie die Kirche nicht an den Rand eines Bruches gebracht. Keiner ist von sich aus gegangen, mancher hingegen durchaus gegangen oder zum Schweigen verurteilt worden. Nun, wo aus Rom der Wind ein ganz klein wenig, nur ein bisschen gedreht hat, kann sich die Truppe der Traditionalisten vor Protest kaum halten und sieht schismatische Tendenzen allerorten. Das Kirchenschiff drohe zu kentern, wenn Innovationen, von denen man als vernunftbegabter Zeitgenosse nicht weiß, ob es nicht eigentlich Überfälligkeiten sind, Einzug halten würden. Stattdessen versucht man es mit der steten Reanimation längst verblichener Traditionen, schmückt sich mit festlichen Gewändern, pflegt alte Liturgien und sonnt sich im Glanz autosuggestiver Erwähltheit. Ein solch prächtiges Schiff, das sich Kirche nennt, wird dann doch wohl auch wieder von der Welt wahrgenommen werden. Alleine: Prunk und Pracht mögen verführerisch sein – vor allem für die Schiffseigner. Nicht, dass das Schiff Petri jenes Schicksal des einst prächtigsten und größten Schiffes der schwedischen Marine teilt, das aufgrund seiner konstruktiven Instabilität am 10. August 1628 nach gut 1300 Metern Fahrtstrecke in ruhiger See bei der Jungfernfahrt sank. Die Vasa war einfach zu kopflastig, zu aufgeblasen über der Wasserlinie, zu wenig Gewicht im Rumpf. Sie war zwar ansehnlich, aber ihr fehlte der Tiefgang. Was die anderen beeindrucken sollte, verschwand einfach von der Bildfläche …
Und noch’n Prozess
In den Zeiten der Krise kann man anfassen – oder einen Prozess starten. Prozesse sind in. In der Kirche überschlagen sich die Prozesse allenthalben. Pfarreientwicklungsprozesse, Pastorale Zukunftswege, synodale Wege, synodale Prozesse und immer wieder gerne Zukunftsprozesse. Die Themen sind eigentlich immer dieselben. Weniger Personal, weniger Gläubige und meist auch (zumindest am Horizont drohend) weniger Geld erzeugen Handlungsdruck. Die Forderungen, das abzuwenden, sind meist ebenfalls dieselben: Aufweichung der Weiheschranken und mehr Mitbestimmung. Die Antworten auf die Forderungen gleichen sich ebenfalls: Gibt es doch alles schon bei den evangelischen Mitbewerbern um die Aufmerksamkeit der Menschen. Bringt auch nichts …
Das Fatale ist: Das Argument der Bewahrer ist nicht falsch – richtig ist es allerdings auch nicht. Das ganze Verfahren, bei dem immer wieder neu in Stuhlkreisen die immer gleichen Dialoge geführt werden, bringt die Kirche nicht nur keinen Deut voran. Die engagierten Streiterinnen und Streiter begehen vielleicht sogar einen massiven Fehler, weil sie die Kirche selbst wieder interessant machen wollen, als sei die Kirche selbst der Zweck. Deshalb wollen die einen, dass sich möglichst wenig ändert, während die anderen danach streben, dass sich ein wenig ändert, das meiste aber bleibt. So fordert man zwar, dass auch Frauen zu Priesterinnen geweiht werden sollen. Das ist gut und schön – stärkt aber letztlich nur den Erhalt eines „Ist“-Zustandes in neuem kosmetischem Gewand. Ähnlich verhält es sich mit der Forderung nach der Aufhebung des Zölibates. Brächten mehr Priester die Kirche wirklich aus der Krise?
Wie gesagt: Diese Fragen sind relevant und wichtig. Nur reicht es nicht, die Lösung permanent einzufordern und sich dann erwartbar negative Antworten bescheiden zu lassen. Liegen die Ursachen für den Relevanzverlust, der eben auch die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, bei denen viel von dem, was in der römisch-katholischen Kirche gefordert wird, faktisch ja schon verwirklicht ist, betrifft, nicht tiefer?
Ausgelotet
Mit Blick auf die anstehenden Forderungen der Gegenwart und angesichts der anstehenden Bundestagswahl am 26. September 2021 formuliert der Soziologe Armin Nassehi in der Wochenzeitung „Die Zeit“ eine Mahnung, die auch für die Herausforderungen gilt, der sich die Kirche der Gegenwart ausgesetzt sieht:
„Wie sind Stabilität und Strukturerhaltung möglich? Wie stellt man Kontinuität in einer volatilen Welt her, wie wird das mit Innovationen kompatibel sein? Sicher nicht, indem man so tut, als würde sich nichts verändern, und sicher nicht dadurch, dass man nur mit allzu durchsichtiger Abwehr auf die Forderungen des Mitbewerbers und potenziellen Partners reagiert (und ihm damit mehr recht gibt, als es manche Akteure glauben).“3)
Es ist eine Situation, der sich das Volk Israel in seinen vielen Facetten immer wieder ausgesetzt sah. Angesichts der Bedrohung des Nordreiches etwa formuliert der Prophet Amos – als Vieh- und Maulbeerfeigenzüchter (vgl. Amos 7,14) eher ein Mann der Tat als theologisch hehrer Worte – eine eindrückliche Mahnung:
Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria, den Vornehmen des Ersten unter den Völkern, zu denen das Haus Israel kommt! Zieht hinüber nach Kalne und seht! Geht von da nach Hamat-Rabba und steigt hinunter nach Gat, ins Land der Philister! Seid ihr besser als diese Reiche? Ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Ihr, die ihr den Tag des Unheils hinausschieben wollt, führt die Herrschaft der Gewalt herbei. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde / und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Musikinstrumente erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen, Ihr salbt euch mit feinsten Ölen, aber über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vorbei. Amos 6,1-7
In dieser Situation wir Gott selbst das Volk Israel in den Senkel stellen, das heißt, es prüfen und gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen:
Dies zeigte mir Gott, der Herr in einer Vision: Er stand auf einer Mauer aus Zinn und hatte Zinn in der Hand. Und der Herr fragte mich: Was sieht du, Amos? Ich antwortete: Ein Senkblei. Da sagte der Herr: Sieh her, mit dem Senkblei prüfe ich mein Volk Israel. Ich verschone es nicht noch einmal. Isaaks Kulthöhen werden verwüstet und Israels Heiligtümer zerstört; mit dem Schwert in der Hand erhebe ich mich gegen das Haus Jerobeam. Amos 7,7-94)
Die Warnung ist eindeutig: Der Verlust der Heiligtümer droht, wenn sich das Volk Israel in Äußerlichkeiten ergeht, ja, in Prunk und Pracht und der Unterdrückung der Armen den eigenen Grund unter den Füßen verliert. Steht die Kirche der Gegenwart nicht genau vor dieser Herausforderung?
Schnappatmung
Manch einer bekommt da Schnappatmung. Das kann kaum verwundern. Die drastische Sprache der Propheten verschlägt denen, die sich getroffen fühlen, zu Recht den Atem. Getroffene Hunde jaulen eben laut auf. Wer aber etwas bewegen will, darf kein Leisetreter sein: Wenn man das Wild aufscheuchen will, muss man schon etwas Lärm machen. Das war wohl auch die Art Jesu, der ja nicht um seiner Nettigkeit willen ans Kreuz geschlagen wurde, sondern weil er sich Feinde gemacht hatte. Das fängt schon mit seinem souveränen Umgang mit den Weisungen der Thora an:
Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, versammelten sich bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben; so halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich; was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Markus 7,1-8
Jesu Verhalten provoziert die, die einfach so an der Überlieferung festhalten. Das ist an sich nicht falsch, aber eben nicht immer lebensdienlich. Es ist aus Jesu Sicht eine Äußerlichkeit, die, wenn sie nicht von innerem Erleben gedeckt ist, nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich ist. Der Mensch ist der Weg, nicht die Tradition. Die Tradition dient dem Leben. Sie ist der immer weiter fortzuschreibende Weg, der nur ein Ziel kennt:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10,10
Dafür tritt Jesus mit seinem Leben ein, kompromisslos und bisweilen mit einer an Sarkasmus, wenn nicht gar zynischen Rhetorik seinen Gegnern gegenüber. Kann man es deutlicher sagen als er selbst, dass kosmetische Aufhübschung des Äußeren alleine nicht hilft?
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie getünchte Gräber, die von außen schön aussehen, innen aber voll sind von Knochen der Toten und aller Unreinheit. Matthäus 23,27
Den so Angesprochenen dürfte wohl der Atem gestockt haben … zumindest, wenn sie sich angesprochen fühlten.
Jesus verkündete das Reich Gottes - gekommen ist die Kirche Alfred Loisy
Immer wieder neu anfangen
Der Satz ist den matthäischen Wehereden Jesu gegen seine Gegner entnommen. Der an die Wehereden anschließende Satz suggeriert, dass die Rede Jesu im Tempel geschah:
Als Jesus den Tempel verlassen hatte, wandten sich seine Jünger an ihn und wiesen ihn auf die Bauten des Tempels hin. Er antwortete und sagte zu ihnen: Seht ihr das alles? Amen, ich sage euch: Kein Stein wird hier auf dem andern bleiben, der nicht niedergerissen wird. Matthäus 24,1-2
Auch dieser Satz dürfte bei denen, die ihn hörten, zu Schnappatmung geführt haben: Kein Stein des Tempels, des Wohnsitzes Gottes, wird auf dem anderen bleiben? Zur Zeit der Entstehung des Matthäusevangeliums war die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n.d.Z. schon Geschichte. Sie war Fakt. Fakt war auch, dass das Judentum seine innere Mitte mit dem Tempel verloren hatte. Das Judentum aber wird daran nicht zugrunde gehen. Die Sehnsucht nach dem Tempel besteht bis heute. Aber schon kurze Zeit nach der Zerstörung des Tempels entsteht aus der Bewegung der Pharisäer das rabbinische Judentum, das bis heute lebt. Die Weisung Gottes, die Torah, die Haggada und die Halacha halten nicht nur die Erinnerung wach. Sie vergegenwärtigen die Geschichte des Volkes Israel – nicht mehr im Tempelkult, sondern in einer neuen Tradition, vor allem auch in der Überlieferung der Familie. Was unglaublich schien, wurde zum Beginn einer neuen Ära: Mit dem Verlust des Jerusalemer Tempels war eben nicht alles aus; im Gegenteil: man machte Ernst mit der Verheißung JHWHs durch den Mund des Propheten Jesaja:
Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr! Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland. Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße, denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im Ödland, um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken. Das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Jesaja 43,18-21
Ist diese Verheißung nicht auch in der großen Vision der Offenbarung des Johannes lebendig, wenn es über das Wohnen Gottes unter den Menschen heißt:
Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Offenbarung 21,5
Die Initiative geht hier wie dort von Gott selbst aus. Er gestaltet den steten Neuanfang. Bei Jesaja ist dieser auch mit einer Rückkehr Israels aus dem Exil in die Heimat verbunden. Trotzdem wird dort alles neu sein. Genau diese Notwendigkeit zu stetem Aufbruch, der sich eben nicht nur in äußerlichen Korrekturen ereignen darf, ist auch der innere Kern dieses Jesuswortes:
Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand; denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Matthäus 9,16-17
Warum nur haben so viele, die – seien sie progressiv, seien sie traditionsbewusst (was hier wie dort in sich eigentlich auch kein Widerspruch sein muss – Angst vor einer radikalen Weiterentwicklung dessen, wofür die Kirche steht. Nirgends in den Evangelien findet man doch den Auftrag, Gemeinden zu gründen. Im Gegenteil! Es gibt eher den Auftrag, in alle Welt hinauszugehen und allen Geschöpfen – allen! – das Evangelium zu verkünden (siehe Markus 16,15). Was aber ist das Evangelium? Markus fasst es im Munde Jesu direkt zu Beginn seines Evangeliums programmatisch zusammen:
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! Markus 1,15
Tief ans Eingemachte gehen
Es ist Zeit, ans Eingemachte zu gehen. Kirche ist kein Zweck, sondern eine Methode, nämlich die Methode, den Auftrag Jesu zu erfüllen und das Evangelium zu verkünden. Wenn da die äußere Form nicht mehr anspricht, reichen kosmetische Änderungen ebenso wenig wie ein Kirchenmarketing, dass die Kirche zur Marke macht. Das ist sie nicht, sie ist der Weg, den Gott zu den Menschen finden will. Der Inhalt der Verkündigung kann sich aber nicht ändern. Das Evangelium, die Weisung Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes sind unveränderlich, die Form, in der es in eine sich stetig ändernde Welt getragen wird, schon. Die Geschichte des Judentums lehrt, dass auch der Verlust einer scheinbar ewigen Tradition eben nicht zum Niedergang führt, wenn das Wesentliche wieder in den Blick gerät. Sollte es bei der Kirche nicht genau so sein? Noch ist die Kirche viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie hat verlernt, sich in die Debatten des Lebens mit Profil und Respekt einzumischen. Sie kreist lieber um sich selbst. Arme Kirche, davon wird dir nur schwindelig. Pass auf, dass du nicht untergehst. Besinn dich auf die Ladung tief im Bauch Deines Schiffes. Da ist der Schatz, der zu den Menschen muss. Deine Takelage, dein Zierrat, deine schönen Offiziersuniformen sind nicht wichtig. Das, was tief in dir verborgen ist, muss wieder gezeigt werden. Der Wind weht doch längst. Warum segelst du noch nicht. Ach, du bist auf Grund gelaufen und jeder weißt dem anderen die Verantwortung zu … Und jetzt? Ärmel hoch, freischaufeln … oder auf ein neues, anderes Schiff warten. So oder so: Ohne Veränderung wird es nicht gehen … und der Wind bläst …
Bildnachweis
Titelbild: Vasa stern color model (Peter Isotalo) – Quelle: Wikicommons – lizenziert als CC By 3.0.
Einzelnachweis [ + ]
| 1. | ↑ | Siehe hierzu insbesondere Artikel 11 der Satzung des synodalen Weges – Quelle: https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Satzung-des-Synodalen-Weges.pdf [Stand: 12. September 2021]. |
| 2. | ↑ | Vgl. hierzu Gottfried Bohl, Synodaler Weg: Bischof Vorderholzer sucht Alternativen, katholisch.de, 4.9.2021 – Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/31126-synodaler-weg-bischof-voderholzer-sucht-alternativen [Stand: 12. September 2021]. |
| 3. | ↑ | Armin Nassehi, Raus aus eurer Käseglocke!, Zeit online, 8.9.2021 – Quelle: https://www.zeit.de/2021/37/die-gruenen-bundestagswahl-2021-klimapolitik-milieu [Stand: 12. September 2021]. |
| 4. | ↑ | Übersetzung Werner Kleine. In der Einheitsübersetzung 1980 ist durchgehend statt von Zinn von „Senkblei“ die Rede. Die Einheitsübersetzung 2016 spricht statt „Senkblei“ von „Zinn“. Tatsächlich ist das hebräisch zugrunde liegende Wort (ענך – gesprochen: anach) ambivalent. In einer Anmerkung weist der Übersetzer hier darauf hin, dass Zinn zur Herstellung von Bronze und damit auch zur Waffenproduktion eingesetzt wurde. In diesem Fall fällt die Drohung sogar noch martialischer aus als im Fall der Einheitsübersetzung von 1980, die freilich das sprichwörtlichen „jemanden in den Senkel stellen“ motiviert hat. In der Stelle geht es aber wohl darum, dass Gott auf einer zinnernen Mauer mit Zinn in der Hand steht, dass der Prophet Amos gefragt als Senkblei erkennt. |