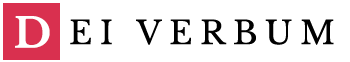den Artikel
Zwischen Bangen und Hoffnung schwankt die Menschheit nahezu täglich in den Zeiten der Corona-Pandemie. Immer wieder wird ein Licht am Ende des Tunnels verheißen, der Rückkehr zur „Normalität“ (was auch immer das ist …), die Lockerung der Beschränkungen, die Öffnung von Friseurläden. All das soll das Volk wohl irgendwie bei Laune halten – bis die nächste infektiöse Welle rollt, der nächste Hotspot aufleuchtet, die neueste Mutation die schönen Pläne zunichte macht. Der moderne Mensch scheint nicht mehr krisenfest zu sein. Der schöne Schein technischer Beherrschbarkeit naturgegebener Urgewalten zerplatzt wie eine schillernde Seifenblase. Auf so etwas ist die aktuell lebende Generation nicht vorbereitet. Die Generation der Alten scheint das noch mit großer Gelassenheit zu nehmen. Sie haben entweder die Entbehrungen des Zweiten Weltkrieges noch miterlebt, zumindest aber die Hungerwinter danach. Sie wissen noch wie Krise geht und lächeln müde über die Probleme ihrer Nachkommen, die in geheizten Wohnungen und gefüllten Kühlschränken über Strom, Gas und Wasser verfügen und bei intakter analoger und digitaler Infrastruktur über verpasste Bildungschancen, ökonomisch-apokalyptischen Szenarien und einen gewaltigen Verlust an Lebensqualität fabulieren, weil es das koffeinhaltige Heißgetränk aus dem Lieblingslokal derzeit nur „to go“ gibt. Wahrlich, das ist eine Krise, die Anlass zu tiefsten Depressionen gibt. Dagegen sind die Hungerwinter und Bombennächte, die auch Menschen in der Gegenwart noch erleben müssen, wohl ein Klacks. Wahre Erschöpfung ist, wenn selbst digital Natives nach den mittlerweile normal gewordenen Webkonferenzen den Laptop zuknallen, um vor einer Netflix-Serie vom wahren Leben zu träumen, als man noch analog im Pausenraum zugegen war und dort digital via WhatsApp chattete. Wann endlich wird es wieder so normal werden?
Krisenambivalenz
Die Nachrichtenlage ist angesichts solch tiefgreifender Krisen des modernen Menschen entsprechend diffus. Die einen schwören etwa auf das föderale politische System der Bundesrepublik Deutschland, weil niemand in Flensburg zu Hause bleiben muss, weil in Garmisch-Patenkirchen der Inzidenzwert steigt; andere finden diesen regulativen Flickenteppich doch äußerst verwirrend, weil man – so scheint es – täglich zwischen Görlitz und Aachen pendelt. Da weiß man natürlich nicht, ob die Regel, die bei Reiseantritt gilt, auch an deren Ende noch Bestand hat. Das sind die wahren Probleme der Gegenwart. Und die Wirtschaft, die leidet natürlich erheblich unter einem Lockdown, der eher das Dienstleistungs- und Einzelhandelsgewerbe betrifft, während die produzierenden Zweige fröhlich weiter wirtschaften – selbstredend ohne Homeoffice; wer wollte sich schließlich ein Presswerk ins heimische Wohnzimmer stellen. Da werden also weiter Werte geschaffen, ebenso im vom heimischen Küchentisch aus betriebenen Verwaltungswesen. Könnte es nicht sein, dass die Wirtschaft im Großen und Ganzen sogar weiterläuft – trotz Lockdown – und man von hier aus überlegen könnte, wie man die, die wirklich schließen müssen, nicht entsprechend, vor allem aber schnell entschädigt?
Auch im Bildungswesen wird geklagt, freilich, wie auch sonst, auf hohem Niveau. Da wurde über Jahre der Ausbau einer digitalen Infrastruktur verschlafen – und jetzt muss alles schnell gehen. Distanzlernen ist angesagt. Ohne Zweifel – der Präsenzunterricht hat mehr zu bieten als Wissensvermittlung. Natürlich ermögliche die physische Nähe eine andere Form der Kommunikation, die wertvoll und wichtig ist. Es sind aber außergewöhnliche Zeiten, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Die Altvorderen kennen noch die Klassenräume, in denen Unter-, Mittel- und Oberstufe gemeinsam unterrichtet wurden. Der Lehrer ging von einer Reihe zur nächsten. Wenn er die eine unterrichtete, mussten die anderen Stillarbeit machen. Ging auch. Die Schülerinnen und Schüler von damals haben es auch so zu etwas gebracht. Die Methode passte sich der gelebten Realität an. Warum fällt es heute manchem Didaktiker so schwer, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen und seine Lehre entsprechend auszurichten? Und warum ist mancherorts dieses Internet immer noch so langsam, das Bits, Bytes und Pixel offenkundig persönlich betreut werden? Wann, um alles in der Welt, ist dieser Tipppoint gewesen, als aus Leistungsbereitschaft und dem Potential zu kreativen Problemlösungen dieses vorrangige Streben nach persönlicher Bedürfnisbefriedigung geworden ist, das in der Krise stockt und deshalb zur Ursache depressiver Stimmungen wird. Wohlgemerkt: Wirklich Depressive leiden. Sie haben nicht bloß schlechte Laune, weil man gerade keine Partys feiern kann …
Frustrationstoleranzen
In dieser Gemengelage hört man dann immer wieder die Verheißung einer baldigen Rückkehr zur Normalität. Alles soll so werden wie früher. Wenn man fleißig Masken trägt, sich die Hände wäscht, Abstand hält und möglichst viele geimpft sind, dann wird es wieder „normal“ werden. Was auch immer diese vermeintliche „Normalität“ ist – jeder Hoffnungsschimmer, der vollmundig nach Wellenbrecherlockdowns oder voreiligen Impfversprechungen, der Ankündigung von Selbsttests oder der Corona-App, am Ende des Tunnels aufleuchtete, entpuppte sich schnell als entgegenkommender Zug, der entweder gefüllt war mit feiernden Menschen, die mal nur für sich eine Ausnahme machen wollten und so Superspreaderereignisse herbeiführten, dem Bedürfnis, wenigstens Weihnachten zu feiern, wie immer (das Virus wird doch wohl wissen, was Weihnachten für uns bedeutet!) oder der Erkenntnis, dass dieses Virus Teil der evolutiven Kraft der Schöpfung ist und einfach fröhlich mutiert. Da sinkt die Laune im gemeinen Volk und man klagt, dass es doch nun mal gut sein müsse. Man müsse mit dem Virus leben lernen – als wenn wir das nicht gerade täten: so lebt man mit dem Virus, wie wir es gerade tun. Das ist die neue Normalität, die gar nicht für alle so schlecht ist. Lernen Schülerinnen und Schüler der Gegenwart nicht gerade eine neue Methode der Bildung? Auf die mögen ihrer Lehrerinnen und Lehrer noch nicht umfassend vorbereitet sein. Aber da scheint etwas Neues auf: Morgens an der Sorbonne, nachmittags in Harvard – digital ist das möglich. Abend trifft man sich dann im heimischen Viertel, um analog zu debattieren. Das nämlich geht digital immer noch nicht so richtig gut – Clubhouse hin, Twitter her. Respekt geht offenkundig richtig nur im analogen Leben …
Hoffnungsschimmer
Es könnte also in all den viralen Herausforderungen doch einen echten Hoffnungsschimmer geben. Dafür aber müsste man den Blick weiten von einer Befriedigung primärer Bedürfnisse hin zu einer Erkenntnis grundlegend kultureller Herausforderungen. Das macht ja Kultur aus, dass sie in der Zähmung der Natur besteht. Die Wüste ist wild. Wer in ihr einen Garten zum Blühen bringt, weil er Wassergräben anlegt und so die Wüste fruchtbar macht, schafft Kultur. Das macht die Wüste nicht inexistent, bildet in ihr aber doch eine Oase. Könnten wir es mit dem Corona-Virus nicht genau so machen? Das aber bedeutet Arbeit, neues Denken, Kreativität. Das würde Hoffnung schaffen, ja Hoffnung sein. Kann man das aber realistisch erwarten – oder ist das nicht eine „Hoffnung wider alle Hoffnung“?
Was ist Hoffnung wirklich?
In der Seelsorge ist das Wort „Hoffnung“ durchaus gebräuchlich – meist aber eher appellativ. Am Ende seelsorglicher Gespräche steht oft der Wunsch für die Beseelsorgten, sie mögen die Hoffnung nicht verlieren. Das ist sicher gut gemeint, entlarvt sich aber ebenso als pastorale Phrase, wie der Wunsch, man möge „viel Kraft“ haben. Hoffnung wird so zu einem pastoraltheologischen Buzz-Word wie „Charismenorientierung“ oder die zwar neuentdeckte, aber letztlich doch klerikal zu zähmende „Würde der Getauften“. Worte, die gesagt werden, ohne dass man sich über deren inhaltliche Referenz Gedanken machen würde. Das aber macht diese Worte zur hohlen Phrase. Dabei ist es gerade die Hoffnung, die in diesen Zeiten wegweisend sein könnten, wenn, ja wenn man sich auf das Wort Gottes besinnen würde. Dort fällt nämlich bei einem kurzen Blick in eine Konkordanz auf, dass das Wortfeld „hoffen“ (ἐλπίζειν – gesprochen: elpízein)/ „Hoffnung“ (ἐλπίς – gesprochen: elpís) vor allem im Corpus Paulinum zu finden ist. Das Substantiv ἐλπίς (elpís) fehlt in den Evangelien sogar vollständig, während das Verb ἐλπίζειν (elpízein) bei Matthäus, Lukas und Johannes insgesamt fünfmal zu finden ist. Ἐλπίς findet sich zwar auch achtmal in der lukanischen Apostelgeschichte; in der Summe aber fällt auf, dass die überwiegende Mehrheit der Stellen, an denen das Wortfeld ἐλπίζειν/ἐλπίς verwendet wird, in den Paulusbriefen zu verzeichnen ist. Für die Verkündigung des Paulus scheint die „Hoffnung“ offenkundig eine besondere Bedeutung gehabt zu haben – und das gilt in besonderer Weise für den Römerbrief, der so etwas wie das theologische Vermächtnis des Paulus, die Summe seiner Verkündigung darstellt. Hier aber fällt auf, dass die „Hoffnung“ (ἐλπίς) in eine innere Relation mit zwei anderen Begriffen gestellt wird: dem Glauben (πίστις – gesprochen: pístis) und der Geduld (ὑπομονή – gesprochen: hypomoné). Das wird schon bei der ersten Verwendung des Worte ἐλπίς im Römerbrief deutlich, wenn es dort heißt:
Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich werden deine Nachkommen sein.
Die Notwendigkeit eines festen Standes
Der Beginn des Zitates verwirrt – zumindest, wenn er, wie hier, ohne Kontext dasteht. Er scheint paradox. Im Kontext aber geht es um den Glauben Abrahams, der beispielgebend ist. Auf diesen Glauben Abrahams wird auch in Römer 4,18 angespielt: Abraham vertrautet Gottes Verheißung, er solle noch trotz des hohen Alters seiner Frau und seiner selbst Vater und so zum Urvater vieler Nachkommen werden. Das ist natürlicherweise nicht mehr zu erwarten, einer Hoffnung, die geradezu lächerlich erscheint – und Sarah, die Frau Abrahams, ja auch lachen lässt (vgl. Genesis 18,10-15). Trotzdem wird sich diese Verheißung erfüllen – gerade, weil Abraham der Verheißung Gottes vertraut. Darauf spielt Paulus an: Glauben ist fest stehende Vertrauen. Das wird auch im Deutschen deutlich, leitet sich „Glauben“ doch etymologisch von „geloben“ ab. Wer etwas „gelobt“, also „glaubt“ bindet sich vertrauensvoll an jemanden. „Glauben“ ist ein Beziehungsvorgang, der auf Vertrauen aufbaut: Ich kann jemandem etwas glauben, wenn die Beziehung intakt ist und ich ihm deshalb vertrauen kann. Wo das Vertrauen fehlt, kann man nichts mehr glauben.
Hier findet das Paradox der „Hoffnung wider alle Hoffnung“ seinen lösenden Schlüssel. Was nach menschlichem Ermessen hoffnungslos erscheint – nämlich, dass die alten und möglicherweise schon greisenhaften Sara und Abraham noch einen Nachkommen bekommen sollen – wird sich erfüllen, weil Abraham aus glaubendem Vertrauen auf Gott die Hoffnung eben nicht aufgibt. Dabei musste er selbst Lehrgeld bezahlen, versuchten er und Sara doch auf eigene Faust der Hoffnung auf die Sprünge zu helfen, indem sie Hagar, Saras Magd verdingten, dem Abraham einen Nachkommen – den Ismael –, zu verschaffen (vgl. Genesis 16). Der aber war weder der verheißene noch der erhoffte Nachkomme. Gott gibt die Hoffnung eben nicht auf. Das mussten Abraham und seine Frau lernen. Wo die Beziehung (in diesem Fall zu Gott!) feststeht, wächst Vertrauen (Glauben) und gibt Anlass zu einer Hoffnung, wo es scheinbar nichts mehr zu hoffen gibt. Ist aber Hoffnung in diesem Sinn nicht surreal und fatalistisch?
Eine Sache der Vernunft
Nicht für Paulus. Er führt den Gedanken weiter und bringt einen neuen Begriff ein:
Gerecht gemacht also aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse; denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Noch einmal bringt er hier die Relation von Glauben und Hoffnung vor, wobei erneut der Glaube als Grund für die Hoffnung erscheint. Im paulinischen Duktus ist es selbstredend der Glaube an Gott. In einem erweiterten Sinn aber kann man das auch als Relation von „Vertrauen“ und „Hoffnung“ fassen. Wo es eine Basis des Vertrauens gibt, kann Hoffnung entstehen. Vertrauen aber braucht einen Erweis der Berechtigung. Bei Paulus ist es die Geburt Isaaks, der Sara und Abraham tatsächlich zu Eltern macht. Im Leben an sich braucht es eben solche Erweise berechtigten Vertrauens, damit Hoffnung Halt finden kann. Hoffnung nämlich erweist sich als krisenrelevant. Bei Paulus sind es die Bedrängnisse, die ihm widerfahren. Der Erweis der Treue Gottes, die in der Erfüllung der abrahamitischen Verheißung sichtbar ist, gibt ihm Anlass zur Hoffnung in seinen persönlichen Krisen. Sie schenkt ihm – und das ist der dritte relevante Begriff – Geduld (ὑπομονή – gesprochen: hypomoné). Es ist also die Hoffnung, die existenzrelevant ist, weil sie zu jener Geduld führt, die einen in der Krise durchhalten lässt. Für Paulus setzt hier ein selbstverstärkender Effekt ein: Geduld bewirkt Bewährung, Bewährung aber bewirkt (Selbst-)Bestätigung und damit Stärkung des Vertrauens, letztlich dadurch wieder Stärkung der Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die der Motor für die Krisenbewältigung ist.
Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Immanuel Kant
Wider die falschen Vertröstungen
Nun könnte man einwenden, dass das alles bestenfalls autosuggestive Vertröstungen sind. Was ist, wenn die letzten Hoffnungen sich nicht erfüllen und die Krise zum Scheitern führt? Hat sich die Hoffnung dann nicht als falsch, mindestens aber als Luftschloss erwiesen?
Paulus ist zu rational, um sich solchen Illusionen hinzugeben. Er weiß um die nihilistische Gefahr. Die Möglichkeit des Scheiterns ist gegenwärtig – aber noch lange kein Grund, fatalistisch alle Hoffnung fahren zu lassen! Deshalb führt er einige Abschnitte später aus:
Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin: Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld.
Die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind real. Sie werden nicht geleugnet – allerdings mit Blick auf das große Ziel relativiert. Das Leiden bekommen so gewissermaßen einen teleologischen Sinn. Ohne Hoffnung wäre alles in sich nichts. Auch das Leiden wäre sinnlos. Dabei findet gerade keine Vertröstung auf ein Jenseits statt. Die Erfüllung der Hoffnungen und der darin begründeten Auflösungen der Leiden werden schon für das Hier und jetzt erstrebt und erhofft. Für Glaubende gilt diese Hoffnung aber auch über das Diesseits hinaus. Dabei wird gerade hier das Wesen der Hoffnung deutlich, das sich aus ihren Relationen zu „Glaube“ und „Geduld“ ergibt:
Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld.
Es ist dem Wesen der Hoffnung inne, dass das Erhoffte eben noch nicht da ist. Hoffnung ist zukunftsgerichtet – und doch nicht fatalistisch. Die Relation zum „Vertrauen“/„Glauben“ aber macht „Hoffnung“ zu etwas Realistischem. Hoffnung ist berechtigt, weil Vertrauen sich schon in der Vergangenheit bewährt hat. Deshalb wird Hoffnung zum Grund, die gegenwärtige Krise mit Geduld zu bewältigen – nicht abwartend, sondern durchaus aktiv; dabei lehrt Abrahams Beispiel, dass vordergründige Bedürfnisbefriedigung in Sackgassen führen kann – auch, weil sie letztlich das Vertrauen brechen. Die Dinge mit bewährtem Vertrauen anzugehen, nährt hingegen die Hoffnung auf eine Lösung, auf die man bisweilen freilich mit Geduld aktiv warten muss.
Um Himmels und der Menschen willen
Am Schluss seines Hymnus‘ auf die Liebe in 1 Korinther 13 findet sich die Trias von Glaube, Hoffnung, Geduld in einer Variante wieder:
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
Hier ist die Geduld der Liebe gewichen. Und doch ist sie in der Liebe aufgehoben, heißt es doch wenige Verse zuvor:
Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Das liest sich durchaus wie eine Wesensbeschreibung der Geduld. Was in der Krise durchhalten lässt, ist also die Hoffnung, die sich aus liebender Geduld nährt. Liebe aber ist beziehungsgerichtet. Wer liebt, handelt nicht um der Befriedigung eigener Bedürfnisse willen, sondern zielt in seinem Handeln auf das Wohl der Anderen. Auch in einer Krise wie der Corona-Pandemie braucht es diese Perspektive, um hoffend aufrecht zu bleiben. Das Licht am Ende des Tunnels ist eine Hoffnung, die auch dann gilt, wenn man noch kein Licht sieht. Wer hier die Geduld verliert, schafft schnell Irrlichter, die den falschen Weg weisen. Das aber führt zu Verwirrung und Vertrauensverlust. Wo das Vertrauen fehlt, kann keine Hoffnung wachsen. Deshalb, Ihr Verantwortlichen, löscht das Vertrauen nicht durch falsche Versprechungen aus. Damit Vertrauen wachsen kann, muss der Wein, den ihr einschenkt, rein sein. Die Hoffnung auf die Bewältigung der Pandemie ist berechtigt. Die Menschheit hat schon andere Seuchen bewältigt – die Pest, die Pocken, Polio wurden durch menschliche Kreativität besiegt. Das ist Kultur, für die es Geduld braucht. Deshalb hofft wider alle Hoffnung. Auch wenn es noch dauert … habt Geduld. Bis dahin aber nutzt die Zeit, schafft und lernt für diese neue Normalität, von der so viele reden. Es kommt der Tag, an dem wir wieder das Leben feiern! Ist er nicht schon da?
Bildnachweis
Titelbild: Graffiti “Never lose hope” (ShonEjai) – Quelle: Pixabay – lizenziert mit der Pixabay License.
Video: “Gott schweigt nicht”, Onlinediskussion zwischen Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine (Dei Verbum direkt, 5.10.2016) – Quelle: Vimeo – Alle Recht vorbehalten.