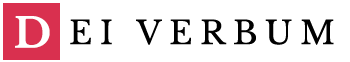den Artikel
Alle Jahre wieder reüssiert in der Karwoche der theologisch gut gemeinte und irgendwie ja auch richtige Hinweis, dass Jesus am Karfreitag wirklich tot war. Man dürfe da nicht schon vorschnell auf den Osterjubel verweisen. Man müsse eben auch den Karsamstag aushalten. Dann aber, mit der Osternacht, ertönt allerorten der Osterjubel mit dem gut gemeinten und irgendwie ja auch richtigen Hinweis, dass der Tod vom Leben verschlungen würde. Mit Inbrunst singt man dann, dass das Grab leer sei (als wenn das irgendetwas beweisen würde…)1), der Held aber erwacht. Die Trauer des Karfreitags, die Mahnungen der eigenen Todesgewissheit, alle die Erinnerungen an Leidende und Sterbende, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie doch so besonders bewusst in den Vordergrund gestellt wurden – scheine in jubeltrunkener Heilsgewissheit unterzugehen, wie sie auch Paulus zweifellos zu eigen war, wenn er ausruft:
Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?
Der Tod bleibt
Der Jubel scheint also doch zu siegen und der Karfreitag schneller vergessen, als es den Mahnenden lieb war. Zumindest, wenn man das eine gegen das andere ausspielen will. Und das tun leider auch viele Karfreitagsmahner, die für einen Tag auf dem sicher richtigen Hinweis insistieren, dass man den Tod eben nicht einfach hinwegjubeln kann, dass man sich ihm stellen muss und ihn nicht anästhetisch selbstsedierend auf eine selbstsuggestive Auferstehungsgewissheit übergehen darf. Das tut nämlich auch Paulus bei näherer Betrachtung nicht, wenn er wenige Verse vor seinem siegestrunkenen Jubelruf ausführt:
Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben; das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden – plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit.
Der Tod bleibt also bei aller Auferstehungshoffnung, die bisweilen sogar bei dem einen oder der anderen Auferstehungsgewissheit sein mag, nicht nur eine unaufgebbare Realität. Im Kelch des Todes wird der Wein des Lebens bis zur Neige geleert, ausgetrunken, vielleicht sogar ausgegossen und verschüttet. Es bleibt nichts vom irdischen Sein. Das Verwesliche muss sterben. Auch wenn Paulus noch in der sogenannten Parusie-Erwartung lebt, also der Hoffnung auf eine schnelle Wiederkunft Christi, mit der die Welt ihre Vollendung findet, und deshalb darauf insistiert, dass nicht alle entschlafen werden – die Verwandlung bleibt trotzdem keinem erspart. Dabei verwendet Paulus hier das Verb ἀλλάσσειν (gesprochen: allássein), das auch die Bedeutung „verändern“ oder „vertauschen“, Letzteres auch mit der Bedeutungsvariante „verwechseln“2) in sich trägt. Bei der Verwandlung, von der Paulus hier spricht, muss man also vorsichtig sein, dass man sie nicht vorschnell mit einer Aufhebung des Todes verwechselt. Das wird deutlich, wenn Paulus wiederum einige Verse vorher eben die Art der Verwandlung näher erläutert:
Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib werden sie haben? Du Tor! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird; es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm den Leib, den er vorgesehen hat, und zwar jedem Samen einen eigenen Leib.
Von hier ausgehend kommt er dann zu dem Schluss:
So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. So steht es auch in der Schrift: Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische; zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische.
Leibleiden
Der Tod bleibt also. Für die Glaubenden, die durch Kreuzestod und Auferstehung Jesus ein prototypisches Schicksal erkennen, bekommt er den Charakter eines Übergangs, in dem eine leibhaftige Verwandlung oder – wie Paulus es im 2. Korintherbrief beschreibt – Überkleidung stattfindet:
Wir wissen: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet, werden wir nicht nackt erscheinen.
Freilich weiß Paulus darum, dass diese Gewissheit – und er spricht diese Gewissheit deutlich in dem Verb οἴδαμεν (gesprochen: oídamen) aus, das eben „wir wissen“ im Sinne des „Wissens“, das kein bloßes Hoffen oder subjektives Für-Wahr-Halten mehr ist, sondern verobjektivierte Erkenntnis – nicht von der Notwendigkeit des Sterbens und des Todes, der der Endpunkt einer zeitlichen, also verweslichen Existenz, die von Werden und Vergehen geprägt ist, entbindet:
Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde.
Gerade Paulus weiß um die leidvollen Aspekte irdisch-leiblicher Existenz. Er leugnet sie nicht, er betet sie nicht weg, er übergeht sie nicht mit dem Hinweis auf eine leidfreie Zukunft in der Ewigkeit. Im Gegenteil – er nimmt das Schicksal der totgeweihten irdischen Existenz, die allen, die leben, aufgegeben ist, an:
Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen.
Und er fügt hinzu:
Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe.
Offenkundig kennt Paulus also die Versuchung der Selbstüberhöhung, die in diesem Zusammenhang als voreilige Todesleugnung verstanden werden kann. Sein persönliches Leiden – und die Metapher vom Stachel im Fleisch deutet durchaus auf ein physisches Leiden hin – versteht er als Mahnung, genau dieser Versuchung der Leidverleugnung nicht zu erliegen. Der Tod ist das schreckliche Ende des Lebens. Sein Schrecken bleibt, weil gewiss ist, dass alles, was dieses Leben ausmacht sein Ende finden wird – und das schneller als man Amen sagen kann:
Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall.
Plötzlich – ἐν ἀτόμῳ (gesprochen: en atómo) – im unteilbaren Aspekt der Zeit – unvorhersehbar. Im kleinsten Augenblick kann die irdische Existenz ihr Ende finden – unvorhersehbar, unplanbar, unangekündigt. Das ist doch schrecklich!
Morituri salutant
Das Leben hängt an dünnem Faden. Er kann schnell zerreißen. In Zeiten von Gesundheit, jugendlicher Stärke und wohlstandsgesättigter Selbstgewissheit mag das schnell vergessen werden. Auf welche Weise man sich auch immer Opiate verschaffen mag – sei es illegal, sei es legal durch Stimulierung der Ausschüttung körpereigener Opioide wie den Endorphinen (und das kann durch Ablenkungen aller Art wie Einkäufe, Fahren mit hoher Geschwindigkeit, Sport oder riskanten anderen Tätigkeiten initiiert werden) – der Kick des Rausches dient in aller Regel dazu, die nihilistische Aussichtslosigkeit einer rein irdisch gedachten Existenz irgendwie erträglich zu machen. Die Sinnlosigkeit des Todes ist tatsächlich kaum zu ertragen – jene endgültige Grenze des irdischen Seins, von der niemand weiß, was danach oder dadurch kommt. Reif sind diejenigen, die als Todgeweihte zu grüßen im Stande sind. Das aus dem mittelalterlichen Mönchtum stammende „mementum mori“ – bedenke, dass du sterblich bist – ist die auf den Punkt gebrachte Weisheit, auf deren Basis wahres Leben erst möglich wird. So wie Licht erst durch den Schatten als Licht erkennt wird – und der Schatten durch das Licht als Schatten, so wird das Leben erst auf dem Hintergrund des Todes bedeutsam, wie der Tod erst durch das Leben als unwiederbringliche Verlusterfahrung aufscheint. Das gilt auch für die jesuanische Verheißung:
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Sie ist kein Versprechen eines paradiesischen Schlaraffenlandes, sondern ein verheißungsvoller Auftrag, das Leben zu ergreifen, sicher in der Ewigkeit, aber eigentlich jetzt schon, hier und heute. Deshalb vergibt er Sünden, deshalb heilt er – wider alle Regel auch am Sabbat –, deshalb spricht er vom nahen Reich Gottes. Nichts und niemand darf von diesem Leben in Fülle abhalten – auch die Todesangst nicht. Nein: Gerade der Tod macht den Wert des Lebens erst deutlich. Wer aber den Tod leugnet – sei es, dass es ein anästhetischer Auferstehungsjubel ist, sei es dass es eine selbstsedierende Sucht nach opioider Berauschung ist –, wird das Leben nicht finden; das Leben in Fülle schon gar nicht. Die sich ihrer Todgeweihtheit Bewussten sind es, die das Leben zu schätzen wissen – jeden unteilbaren Moment im Hier und Jetzt schon.
Eine bleibende Demütigung
So sind Leiden und Tod bleibende Demütigungen – gerade in Zeiten, in denen der moderne Mensch trotz allen Fortschritts in Wissenschaft, Technik und Medizin erfahren muss, dass ein kleines Virus – ein evolutionäres Überbleibsel, weder tot noch lebendig, dem vorläufigen Höhepunkt der Evolution die selbstaufgesetzte Krone der Schöpfung vom Haupte zu reißen droht. Wieder einmal scheint ein Leben in Fülle in weite Ferne gerückt. Wieder alle vorschnelle Beruhigung steht die Menschheit wieder einmal vor einer Situation, die auch den biblischen Klageliedern aufscheint:
Die Alten bleiben fern vom Tor, die Jungen vom Saitenspiel. Dahin ist unseres Herzens Freude, in Trauer gewandelt unser Reigen. Die Krone ist uns vom Haupt gefallen.
Die Beter der Klagelieder sehen dabei in sich selbst die Urheber der Krise:
Weh uns, wir haben gesündigt!
Aufgrund der Erfahrungen ihrer eigenen Geschichte sehen sie den Ausweg in einer Hinwendung zu JHWH als Geber und Garant des Lebens:
Du, HERR, thronst ewig, dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen fürs ganze Leben? Lass du, HERR, uns zurückkehren zu dir, dann kehren wir um! Erneuere unsere Tage wie in der Urzeit. Oder hast du uns denn ganz verworfen, zürnst du uns über alle Maßen?
Ob der moderne, vernunftstolze Mensch, der seine Zweifel doch eigentlich los sein wollte, diese Konsequenz nachvollziehen kann. Es ist doch offenkundig besser, den Virologen, Epidemiologen und anderen Wissenschaften zu trauen, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden. Daran kann kein Zweifel bestehen – auch nicht auf dem Hintergrund der Klagelieder, denn das Volk, das hier klagend betet ist zuerst der Solidarität verlustig gegangen. Es ist die gemeinsame Hinwendung zu JHWH, die – selbst, wenn sie klagend ist – als gemeinsamer Akt ein erster Schritt zu neuer Solidarität und damit zu neuer Stärke ist. Die entsteht aber erst aufgrund einer gemeinsamen Erfahrung im Leid. Erst das Nichtleugnen des Leides, sein Aussprechen in der Klage macht einen gemeinsamen Neuanfang möglich.

Denkmal Wundmal
Das ist der eigentlich Punkt: Das Leid darf nicht geleugnet werden. Es bleibt selbst in der Rückschau Leiden. Viele reden jetzt, wie der selbst ernannte Zukunftsforscher Matthias Horx von „Regnosen“3), bei denen man sich wundern würde, wenn Corona vorbei ist:
„Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele von sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte – und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst.“4)
Solche Redeweisen, in denen die Krise immer als Chance erscheint, ist – mit Verlaub – zynisch. Sie ist egomanisch auf die Überlebenden fixiert, auf die, die irgendwie durchgekommen sind, die es mehr oder weniger unbeschadet hinter sich haben. Wo sind da die Toten, die Hinterbliebenen, die, die auch nach durchstandener Infektion möglicherweise mit Spätfolgen zu kämpfen haben, wo sind die anderen Corona-Opfer, die ihre wirtschaftliche Existenz verloren haben? Ein solcher selbsternannter „Zukunftsforscher“ macht den Fehler, den religiöse Schwärmer und Worshipper zu allen Zeiten gemacht haben: Sie lobpreisen nur und klagen nie, sie jubilieren über eine Auferstehung, die die Wundmale am Leib des Auferstandenen nicht wahrhaben will. Das ist doketistisch5), weil es nur den schönen Schein der Auferstehung, nicht aber den demütigenden Schmerz des Kreuzestodes wahrhaben will. Der Auferstandene selbst aber trägt immer noch die Wundmale des Todes an sich. Sie sind selbst im verwandelten Leib eingeprägte Narben, Denkmäler des Lebens, das erst im Tod zu sich selbst kommt, ja, erst auf dem Hintergrund des Todes Leben in Fülle sein kann:
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
Das Neue wird sichtbar. Kein Irdischer könnte durch verschlossene Türen gehen. Der Leib ist verwandelt – er ist diskontinuitiv. In dieser Diskontinuität ist aber in personaler Kontinuität das ganze Leben in Trauer und Freude, Leid und Heil, Tod und Leben aufgehoben.
Eine schreckliche Erfahrung
So ist Ostern zuerst eines: Die schreckliche Erfahrung der eigenen Todgeweihtheit. Die Auferstehung von den Toten ist nicht ohne den Tod zu haben. Deshalb trägt selbst die Osterkerze als Auferstehungssymbol schlechthin die Wundmale als Denkmäler des Todes Jesu. Ostern ist aber noch in einer anderen Perspektive eine fürchterliche Erfahrung, steht doch vor dem Jubel das Erschrecken:
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; 3 sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden.
Aufgrund der Entdeckung des leeren Grabes, ja selbst auf den Hinweis auf deutende Engel entstehen auch nicht Jubel und Glauben, sondern Aufregung:
Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe.
Oster – das ist zuerst eine schreckliche Erfahrung. Es ist die Erfahrung, dass der Tod ist, was er ist: Tod. Und es ist für die, die glauben können, die schreckliche Erkenntnis der Größe Gottes, der so ein Leben in Fülle bereitet, das den Tod einschließt. Oster – das eine revolutionäre Herausforderung für das Leben, die Hoffnung, den Verstand. Jubelt nicht zu früh! Lebt! Und klagt über Leid und Tod, denn die sind schrecklich! Klagt laut, damit ihr irgendwann wieder jubeln könnt – gemeinsam! Er ist auferstanden, aber vorher gestorben. Ululate, tum jubilate!
Bildnachweis
Titelbild: Broken Egg orange (Goldmund100) – Quelle: Wikicommons – lizenziert als CC BY 3.0.
Bild 1: Rühr mich nicht an/Talpassion 2014 (Annette Marks – Foto: Christoph Schönbach/Katholische Citykirche Wuppertal) – alle Rechte vorbehalten.
Einzelnachweis
| 1. | ↑ | Zur Diskussion um das leere Grab siehe auch den lesenswerten Exkurs in Karl Lehmann: Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift. Früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 Kor. 15,3-5, Freiburg i.Br. 2004, S. 58-63 und Werner Kleine, Voll leer. Ein Essay über das notwendig Paradoxe im Glauben, Dei Verbum, 27.3.2018, https://www.dei-verbum.de/voll-leer/ [Stand: 12. April 2020]. |
| 2. | ↑ | Vgl. hierzu etwa Röm 1,22-23: „Sie behaupteten, weise zu sein, und wurden zu Toren und sie vertauschten (ἤλλαξαν – gesprochen: éllaksan) die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen.“ |
| 3. | ↑ | Vgl. hierzu Matthias Horx, Die Welt nach Corona, Quelle: https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ [Stand: 12. April 2020]. |
| 4. | ↑ | Matthias Horx, Die Welt nach Corona, Quelle: https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ [Stand: 12. April 2020] (Hervorhebungen im Original). |
| 5. | ↑ | Vom griechischen δοκεῖν (gesprochen: dokeîn): „scheinen“. |