den Artikel
Schon für ein wenig Trockenfutter lässt sich eine ganze Herde Schafe bereitwillig und zur Gänze melken. Schwarze Schafe stehen dann friedlich neben weißen und gefleckten, großen und kleine. Es gibt keine Unterschiede. Wenn alle aus dem einen gemeinsamen Trog fressen können, den Kopf eingespannt in das Joch, das alle zu Gleichen macht, dann gibt das Schaf gerne die Milch, die den Wert des Futters mehrt. Alle sind dann gleich an den Produktionsmitteln beteiligt – und merken doch nicht, dass der Bauer gleicher als die Herde ist und seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Vielleicht ist das gemeinsame Fressen ja sogar das Geheimnis hinter dem merkwürdigen Verhalten des Hirten im Gleichnis vom verlorenen Schaf, der die 99 Schafe wahlweise in den Bergen (vgl. Matthäus 18,12-13) oder in der Wüste (vgl. Lukas 15,4-7) ohne jede Aufsicht und Sicherung zurücklässt, um das eine zu suchen. Was auf den ersten Blick als absurdes Verhalten des Hirten erscheinen mag, ergibt einen Sinn, wenn man die Futterliebe der blökenden Herde kennt: Ein wenig Nahrung genügt, um die wolligen Tiere eine Zeitlang zu beschäftigen …
Kühn – Kühner – Kühnert
Der Vorsitzende der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, hat der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ ein Interview gegeben1) und sich – welche Überraschung für einen Jungsozialisten – als Sozialist geoutet … und nicht nur das politische Establishment in Deutschland steht Kopf. Ungeachtet der Tatsache, dass der Juso-Vorsitzende zwar über die Macht des Wortes, weder aber über die eines politischen Mandates noch einer besonderen Weisungsbefugnis der SPD als Mutterpartei gegenüber verfügt, scheinen die professionellen Kaffeesatzleser der Gegenwart allein schon aufgrund eines Gedankenspiels, das indes noch durch die suggestive Fragetechnik der Interviewer evoziert wurde, eine unmittelbar bevorstehende grundlegende gesellschaftliche Umwälzung anzunehmen. Was aber ist genau geschehen?
Das Interview beginnt mit ein wenig Eingangsgeplänkel, in dem auch das sozialistische Ideal, eine bessere Welt sei nicht bloß denkbar, sondern realisierbar, zur Sprache kommt – was für Kevin Kühnert konkret bedeutet:
„Eine Welt freier Menschen, die kollektive Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und nicht Profitstreben.“2)
Während man hier noch schelmenhaft an die bedürfnisorientierte Schafherde denkt, die in der Suggestion, frei zu sein, dem Profit des Hirten dienen, formuliert Kevin Kühnert einige Zeilen später dann doch kühner, was er persönlich unter einem modernen Sozialismus versteht:
„Was unser Leben bestimmt, soll in der Hand der Gesellschaft sein und demokratisch von ihr bestimmt werden. Eine Welt, in der Menschen ihren Bedürfnissen nachgehen können. Eine Demokratisierung aller Lebensbereiche.“3)
In der Tat muss man die Zeilen genau lesen, denn Kevin Kühnert redet hier nicht einfach von Verstaatlichung, sondern von Vergesellschaftung und Demokratisierung. Das bleibt freilich immer noch diffus, so dass die Interviewer den Interviewten weiter in eine Richtung drängen, so dass alles schließlich auf das sozialistisch intendierte Gedankenspiel einer „Kollektivierung von Unternehmen wie BMW“ hinausläuft4). Wohlgemerkt: Nicht Kevin Kühnert bringt diese Assoziation ein. Sie wird durch die Interviewfragen intendiert, wenn nicht gar souffliert. So oder so – schließlich kulminiert das kühne Gedankenspiel in Kühnerts Antwort auf die Frage, ob er eine Kollektivierung von Unternehmen wie BMW anstrebe:
„Auf demokratischem Wege, ja. Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ‚staatlicher Automobilbetrieb‘ steht oder ‚genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘, oder ob das Kollektiv entscheidet, BMW braucht es in dieser Form nicht mehr. Die Verteilung der Profite muss demokratisch kontrolliert werden. Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer an diesem Betrieb gibt. Ohne eine Form der Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus überhaupt nicht denkbar.“5)
Wohlgemerkt: Das ist kein SPD-Parteitagsbeschluss noch eine Gesetzesentwurf; es ist bloß ein Gedankenspiel eines offenkundig hochmotivierten Jungsozialisten, der – oh Wunder – sozialistisch denkt! Dem muss man nicht zustimmen. Die Reaktion der Öffentlichkeit aber zeigt, dass das Gedankenspiel einen Nerv trifft. Es ist eine offensive Anregung für eine vielleicht überfällige Debatte. Über Anregungen sollte man sich aber nicht aufregen, sondern reflektiert und angeregt in die Debatte einsteigen; oder, um es mit den Worten des Verfassers der Jakobusepistel zu sagen:
Wisset, meine geliebten Brüder und Schwestern: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn; denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott.
Bevor also das Temperament in Wallung gerät und zu vorschnellen Antworten drängt, sollte man also um Verstehen des Gehörten ringen und dann eine aus gediegener Reflexion erwachsende Antwort finden. Im Raum steht freilich die Frage: Kann der Sozialismus überhaupt real existieren, ohne dass die Bedürfnisbefriedigung der Schafe sie gleichzeitig ihre Freiheit kostet und sie doch den Hirten einen unverdienten Profit ermöglichen, oder erweist er sich als nette, aber letztendlich im Idealen verbleibende Utopie? Und wenn ja: Gibt es eine Alternative, die dem berechtigten Anliegen einer gerechten Verteilung der Mittel entspricht, die die Individualität und Freiheit der Einzelnen achtet, ohne neue Ungerechtigkeiten zu schaffen?
Ein biblischer Denkversuch ...
Die Utopie einer gerechten Gesellschaft, in der alle alles gemeinsam haben, findet sich auch im Neuen Testament. Es ist Lukas, der in der Apostelgeschichte ein solches Idealbild der christlichen Urgemeinde zeichnet, wenn er im Anschluss an die Pfingstpredigt des Petrus und die ersten Taufen schreibt:
Alle wurden von Furcht ergriffen; und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.
Lukas schaut mit einem zeitlichen Abstand von gut 50 Jahren auf die von ihm geschilderten Ereignisse zurück. Die Zustände sind in der Tat zu schön, um wahr zu sein. Wahrscheinlich hält Lukas seiner eigenen Gemeinde ein solches Idealbild vor Augen, weil die Zustände in dieser Gemeinde so völlig anders sind. In der Tat findet man in den christlichen Gemeinden der zweiten und dritten Generation zahlreiche Repliken auf solche sozialen Missstände, die oft auf einen müde gewordenen Glauben und gelähmten Glaubenseifer zurückgeführt werden. So mahnt der Verfasser der Jakobusepistel schon im Eingangskapitel:
Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Vater: für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person! Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt: Setz du dich hier auf den guten Platz! und zu dem Armen sagt ihr: Du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen! – macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken? Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern! Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen entehrt. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen? Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!, dann handelt ihr recht. Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person handelt, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz überführt, dass ihr es übertreten habt.
Auch der Autor des Schreibens an die Hebräer sieht sich zu abschließenden Mahnungen gezwungen, die nur dann Sinn machen, wenn das so Angemahnte gerade nicht dem gegenwärtigen Zustand der adressierten Gemeinde entspricht:
Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt! Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen; denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib! Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt; denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Habgier; seid zufrieden mit dem, was ihr habt; denn Gott selbst hat gesagt: Ich werde dich keineswegs aufgeben und niemals verlasse ich dich. So dürfen wir zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun?
... der auch nur eine offenkundige Utopie beschreibt
Tatsächlich entpuppt sich auch das sozialistisch anmutende Ideal des Lukas von der christlichen Urgemeinde als Utopie, die einer dem Menschen mehr oder weniger innewohnenden Gier zuwiderläuft. Zwar schildert Lukas wenige Absätze später erneut die Gütergemeinschaft der Urgemeinde mit eindringlichen Worten:
Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit, gebürtig aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt: Sohn des Trostes, genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Dem generösen Verhalten der Genannten läuft allerdings das betrügerische und auf den eigenen Vorteil bedachte Verhalten anderer entgegen, das Lukas in unmittelbarem Anschluss schildert:
Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Saphira verkauften zusammen ein Grundstück und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. Und über alle, die es hörten, kam große Furcht. Die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach etwa drei Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus fragte sie: Sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft? Sie antwortete: Ja, für so viel. Da sagte Petrus zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür; auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten.
Allein schon diese Episode zeigt, dass jeder Sozialismus – auch ein christlich anmutender – am menschlichen Individualismus scheitern, weil auch der Sozialismus nicht ohne Sozialstruktur auskommt; die Sozialstruktur aber gibt den einen Macht über die anderen. In jeder Herde gibt es, wenn schon keine Hirten, so doch den Leithammel, der früher ans Futter darf als die anderen. Und wenn es einen Hirten gibt, nimmt er den Schafen für ein wenig Futter die hart erfressene Milch … Der eigene Vorteil macht auch den frömmsten Christen zu einem unsolidarischen Zeitgenossen. Wenn er schon nicht wie Hananias und Saphira bigott frömmelnd die Gemeinschaft um den solidarischen Anteil betrügt, dann sonnt sich der Fromme doch gerne im Glanz einer vermeintlich erworbenen Heiligkeit, die auf dem Hintergrund des selbst suggerierten Bewusstseins, das alle, die weniger fromm sind schon ihre Strafe erhalten werden, noch wohliger den Sinn benebelt. Sollte der wahre Christ aber nicht wissen, dass er längst erlöst ist und denen, die noch in der Angst leben – so sie denn in der Angst leben – die Botschaft von der Erlösung verkünden? Jede Eitelkeit aber ist Ausdruck mangelnder Nächstenliebe. Manch ein Frommer wird daher wundern, in welche Gesellschaft er da selbstverdient im Angesicht der Ewigkeit geraten wird …
Der Sozialismus und die Freiheit
Das Problem des Sozialismus ist und bleibt das utopische Surrogat einer umfassenden Freiheit aller bei gleichzeitiger Bedürfnisbefriedigung aller. Letzteres ist nur durch eine umfassende, meist staatliche Kontrolle zu erreichen, die aber immer die Freiheit beschädigt und meist auch in eine diktatorische Bevorzugung der Mächtigen mündet. Die, die nicht mitspielen, haben keine Chance. Die Strafen sind hart. Selbst der christlich verbrämte Sozialismus der Urgemeinde zieht den Tod derer nach sich, die nicht so mitmachen, wie das Ideal es fordert. Man mag das noch so sehr als Gottesurteil verbrämen – die Freiheit der Einzelnen wird beschädigt. Sozialismus und Freiheit scheinen keine Geschwister zu sein …
Eine christliche Alternative?
Auch in den paulinischen Gemeinden scheint das auf Nächstenliebe gegründete Ideal einer Gütergemeinschaft wenigstens als Ansporn existiert zu haben – freilich in einer durch die real existierenden Verhältnisse geschliffenen Form. So geht es im Philemonbrief um die Rückschickung des Sklaven Onesimus zu seinem Herrn Philemon. Paulus beweist angesichts der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die den historischen Kontext des Philemonbriefes ausmachen, Realitätssinn, wenn er schreibt:
Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das bedeutet mein Innerstes. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, sondern als weit mehr: als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich, um wie viel mehr dann für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf wie mich! Wenn er dich aber geschädigt hat oder dir etwas schuldet, setz das auf meine Rechnung!
Der Sklave bleibt Sklave, der Herr bleibt Herr. Was aus heutiger Sicht nachgerade unchristlich anmutet, bildet die gesellschaftliche Realität ab, in der Paulus existiert. Er kann sie nicht einfach ändern. Und doch schafft er eine neue Realität, für die er persönlich eintritt: Er verbürgt sich für den Schwachen und Rechtlosen. Er nimmt seine möglichen Schulden auf sich. Durch diese Bürgschaft macht er aus dem Sklaven einen Bruder – zuerst für sich, durch die Gemeinschaft (κοινωνία – gesprochen: koinonía), die ihn mit des Sklaven Herrn Philemon verbindet, dann aber auch mit dem Herrn. Das Verhältnis Herr-Sklave bleibt bestehen und wird doch so anders. Es ist die praktische Konsequenz, die das bewirkt – eine Praxis, die jede Utopie übersteigt. Im Tun wird die Utopie zur Realität, die Vision zur Wirklichkeit. Hier wird Gemeinschaft nicht behauptet, sondern gelebt – im Eintreten des Starken, für den Schwachen; und das, obwohl der Starke selbst als Gefangener in keiner Situation der Stärke ist. Wenn das keine Solidarität ist …
Solidarität
Freilich ist auch das solidarische Eintreten der Starken für die Schwachen an sich ein Ideal, das nur allzu oft an der Wirklichkeit scheitert. Paulus selbst muss diese Erfahrung machen. Während er über die Gemeinde von Philippi sagen kann, er sei mit ihr in Geben und Nehmen verbunden (vgl. Philipper 4,15), muss er in Korinth beobachten, wie selbst beim Herrenmahl die Starken die Schwachen übervorteilen:
Wenn ich schon Anweisungen gebe: Das kann ich nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt; zum Teil glaube ich das auch. Denn es muss Parteiungen geben unter euch, damit die Bewährten unter euch offenkundig werden. Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrenmahls; denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben.
Es ist dieses unsolidarische Verhalten, dass den Leib Christi letztlich zerstört und zu einer unwürdigen Feier des Leibes Christi führt:
Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt.
Wohlgemerkt: Es geht hier um die unwürdige Art und Weise des Feierns, nicht um das Feiern Unwürdiger. Das Wort „unwürdig“ (ἀναξίως – gesprochen: anaxíos) in 1 Korinther 1,27 ist kein Adjektiv, sondern Adverb!
Freilich stellt Paulus auch hier seinen Realitätssinn unter Beweis. Er weiß, dass sich das Verhalten der Menschen an sich nur schwer verändern lässt – wenn es nicht gar unmöglich ist. Deshalb bedarf das solidarische Miteinander einer sozial verträglichen Regel:
Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander! Wer Hunger hat, soll zu Hause essen; sonst wird euch die Zusammenkunft zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich komme.
Die Starken sollen ihren Bedürfnissen so nachkommen, dass sie die Schwachen nicht beschämen und doch so mit den Schwachen teilen, dass auch deren Bedürfnisse Befriedigung finden. So wird die Freiheit der Einzelnen gewahrt und doch Solidarität ermöglicht.

Geben und Nehmen nach Menschenart
Der Mensch kann sich nicht einfach ändern. Charakter, Veranlagung, Neigungen, Erziehung, Sozialisation – all das und noch mehr determinieren ihn mehr, als ihm lieb sein kann. Die Freiheit ist immer eine determinierte. Damit aber selbst in eigentlich der Nächstenliebe verpflichteten christlichen Gemeinschaften der Mensch dem Menschen nicht zum Wolfe wird, müssen Regeln geschaffen werden. Auch Solidarität braucht solche Regeln. Eine ist, dass die, die mehr haben, auch mehr geben können, als die, die weniger haben. So führt es Paulus mit Blick auf das Kollektenwerk, das der Unterstützung „der Armen“ in der offenkundig an finanziellen Mitteln nicht sonderlich reichen Jerusalemer Urgemeinde dienen soll (vgl. Galater 2,10), im 2. Korintherbrief aus:
Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen, wie es in der Schrift heißt: Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel, und wer wenig, hatte nicht zu wenig.
Solidarität in diesem Sinn gründet immer auf einem Ausgleich, der freilich nicht immer materieller Natur sein muss. Im Beispiel der Jerusalemer Kollekte besteht der Ausgleich in der Vermehrung des an Gott gerichteten Dankes über die heidenchristlichen Gemeinden – damals eine echte Herausforderung für die junge Kirche aus Heiden und Juden:
Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk!
Solidarität beruht also im Unterschied zum Sozialismus auf einer Wechselwirkung zwischen Starken und Schwachen: Die Starken geben, damit die Schwachen leben können. Dadurch entstehen stabile Verhältnisse, sozialer Frieden, Sicherheit. Auch die Schwachen müssen also ihren Teil „leisten“. Es geht nicht bloß um Umverteilung. Es geht um Abbau materiellen Überflusses, der den Starken nicht wirklich schadet, sondern die Basis einer Sicherheit schafft, die durch soziale Unausgewogenheiten gefährdet wird. Hier geht es nicht mehr um fressende Schafe, die sich bereitwillig melken lassen – egal ob der Hirte nun Kapitalist oder Sozialist ist. Hier geht es um die Suche des Verlorenen, des Gefährdeten, um die Wiederherstellung der Würde aller!
Kevin sei Dank!
Man kann und muss Kevin Kühnert dankbar sein, dass er mit seinen Thesen eine wichtige Debatte anstößt. Man kann und muss als überzeugter katholischer Demokrat verwundert über die bisweilen aggressiven Reaktionen sein, die das fremdimplementierte Gedankenspiel Kevin Kühnerts auslöst. Man muss ihm nicht zustimmen. Man darf und soll ihm widersprechen – aber doch bitte mit Stil. Es ist wie bei Lukas, der seiner Gemeinde, deren Verhältnisse offenkundig kritikwürdig sind, ein idealisiertes Bild der Urgemeinde vor Augen führt: Die Art und Weise der Reaktionen auf Kevin Kühnerts Thesen zeigen, wie wichtig der Diskurs um das Wie der gegenwärtigen Gesellschaft ist. Sicher: Niemand in der Bundesrepublik Deutschland muss hungern. Die Grundsicherung ist gewährleistet. Aber ermöglicht sie auch ein wirklich menschenwürdiges Leben? Ist es menschwürdig, auf dem Sozialamt wie Bittsteller auftreten zu müssen, während andere in einem Reichtum schwelgen, den sie im Leben nicht aufzehren könnten? Wenn der soziale Friede gewährleistet sein soll, muss Solidarität neu definiert und ausgeübt werden. Das wird nicht ohne (staatliche) Regeln gehen. Die Freiheit wird nur existieren können, wenn sie im Geben und Nehmen erworben wird. Ein Paradox? Sicher! Aber ein weit kleineres als das Paradox, dass aller Reichtum das Leben um keinen Tag verlängern kann. Seid solidarisch, bevor ihr sozialistisch enteignet werdet! Oder, um es mit Jesus zu sagen:
Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht!
Es ist doch nur Geld …
Bildnachweis
Titelbild: Schafherde (Werner Kleine) – lizenziert als CC BY-SA 4.0.
Bild 1: Melkstand (Werner Kleine) – lizenziert als CC BY-SA 4.0.
Einzelnachweis
| 1. | ↑ | Vgl. hierzu Jochen Bittner und Tina Hildebrandt, Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?, Zeit online, 1.5.2019, Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht [Stand: 6. Mai 2019]. |
| 2. | ↑ | Jochen Bittner und Tina Hildebrandt, Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?, Zeit online, 1.5.2019, Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht [Stand: 6. Mai 2019]. |
| 3. | ↑ | Jochen Bittner und Tina Hildebrandt, Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?, Zeit online, 1.5.2019, Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht [Stand: 6. Mai 2019]. |
| 4. | ↑ | Vgl. hierzu Jochen Bittner und Tina Hildebrandt, Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?, Zeit online, 1.5.2019, Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht [Stand: 6. Mai 2019]. |
| 5. | ↑ | Jochen Bittner und Tina Hildebrandt, Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?, Zeit online, 1.5.2019, Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht [Stand: 6. Mai 2019]. |
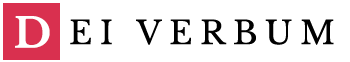





Der Christ sagt: Was mein ist, sei auch Dein (Anspielung auf Joh. 10:17).
Der Sozialist formuliert etwas anders: Was Dein ist, sei auch mein.
Der Unterschied zwischen Christentum und Sozialismus ist nur scheinbar klein…
Viele Grüße
Daniel Offermann
Das stimmt – und er ist doch wesentlich. 😉
Auch interessant – der Pastoraltheologe Rainer Bucher im Gespräch mit Christiane Florin im Deutschlandfunk: Kapitalismuskritik – Jesus trifft Kevin. https://www.deutschlandfunk.de/kapitalismuskritik-jesus-trifft-kevin.886.de.html?dram:article_id=448036