den Artikel
Die Gemeinde ist tot! Es lebe die Gemeinde! In ständiger Selbstperpetuierung wird die Gemeinde beschworen, endlich aufzubrechen und in pastoralen Suchbewegungen und Pionierprojekten1) den Ausweg zu finden, der den vermeintlichen Gläubigenmangel und die Glaubensverdunstung in der Gesellschaft stoppt. Die Gemeinde ist das Subjekt der Suchbewegung schlechthin. Die Ratlosigkeit der kirchlichen Leitungsebene angesichts der Herausforderungen, die sich der Verkündigung des Wortes Gottes stellt, scheint groß zu sein. Und so setzt man letztlich, selbst wenn man sich „fresh expressions“ (frischer Ausdrucksweisen) bemüht, auf die bewährten Denkmuster vergangener Epochen: Die
„neuen Formen wollen niemals bestehende Gemeinden ersetzen, sondern ergänzen und bereichern. Unter dem Stichwort mixed economy existieren die unterschiedlichsten Gemeindeformen gleichberechtigt nebeneinander und bilden gemeinsam eine Kirche.“2)
Wie es zur Idee „Gemeinde“ kam
Als Ideal scheint dabei immer noch die „christentümliche Gesellschaft“ des Mittelalters, in der das ungeteilte abendländische Christentum die Gesellschaft grundlegend und flächendeckend prägte3). Diese Einheit zerbrach nicht nur durch die Reformation; die Aufklärung stellte die unhinterfragten religiösen Selbstverständlichkeiten, Gottes- und Weltbilder an sich in Frage.
Im Zuge der industriellen Revolution kamen weitere gesellschaftsprägende Faktoren hinzu, die die Religion als sinnstiftende Mitte bedrängten. Der Rückzug in Milieus schuf interne Konsistenzen, die mit klaren Abgrenzungen anderen Milieus einhergingen4). Man war jetzt nicht mehr einfach Christ; vielmehr traten die konfessionellen Bindungen stark in den Vordergrund – eine Entwicklung, die Franz-Xaver Kaufmann als „Verkirchlichung des Christentums“5) bezeichnete. In dieser Entwicklung kam der Gemeinde-Idee eine spezifische Bedeutung zu. Die Gemeinde – oder besser: die Pfarrei – bildete den strukturellen Rahmen, innerhalb dessen das konfessionelle, insbesondere das katholische Milieu gedeihen konnte. Die sozialen Kontrollsysteme taten das Ihre, sodass die Zugehörigkeit zur territorial umschriebenen Pfarrgemeinde eine unhinterfragbare Selbstverständlichkeit von hoher integrativer Bedeutung war. Deshalb kannHerbert Haslinger lakonisch feststellen:
„Die Bindung an eine Gemeinde blieb gleichsam ‚auf Automatik gestellt’.“6)
Gemeinde „in situ“
Gemeinde war in diesem Konzept ein territoriales Konstrukt, dem man durch Zuzug eingegliedert wurde. Christsein ereignete sich durch Teilnahme am gemeindlichen Leben, vor allem aber durch die Teilnahme an den in der Gemeinde vollzogenen sakramentalen Handlungen, die das Leben in seinen Vollzügen gleichsam rituell durchdrangen. Das Milieu und die milieubedingte Sozialkontrolle prägte auch den Alltag und dessen Vollzüge: Feste, Freizeitgestaltung, freitägliches Verbot von Fleischgenuss, Fronleichnamsfest – all das spielte sich nicht nur im katholischen Milieu ab; es schuf und sicherte Identität. Man wusste halt, wohin man gehörte. Der Pfarrer kannte seine Pfarrkinder. Die Kirche war Dorf – verlässlich von der Wiege bis zur Bahre. Katholisch zu sein war kein Event oder eine Eigenschaft unter vielen anderen. Katholisch zu sein war ein dauerhafte, lebenslängliches Konstitutivum, ein statisches Gerüst, das dem Leben Halt gab.
Sehnsuchtsseufzer
Im Angesicht der gegenwärtigen Herausforderungen wird mit sehnsuchtsvollem Blick auf die vermeintlich goldenen Zeiten versucht, den Patienten Gemeinde mit allen Mitteln zu reanimieren. Immer noch erscheint die Gemeinde als der kirchliche Ort schlechthin7); mehr noch: das pastorale Heil kirchlichen Handelns wird nahezu ausschließlich in einer Restauration des gemeindlichen Konzeptes gesehen. Statt von Priestermangel redet man dann lieber von Gläubigenmangel. Die Option für das Ehrenamt wird beschworen; ein guter Christ ist, wer sich in der Gemeinde engagiert. Davor haben dann selbst hauptamtliche Laien im pastoralen Dienst zurück zu stehen. Bei jeder sich bietenden pastoralpraktischen Gelegenheit wird der Ruf laut, dass sich die Gemeinden hier und da und überhaupt zu engagieren hätten. Allein: Der Ruf verhallt schon seit Jahrzehnten. Die goldene Ära der 70er- und 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts mit seinen Aufbrüchen ist vergangen. Die großen pastoralkonzeptionellen Planungen der 90er- und 00er-Jahre haben keine wirklichen Aufbrüche bewirkt – wie sonst könnte man die Inflation immer neuer Suchbewegungen erklären, die ausgerufen werden, kaum dass der letzte Dialogprozess sein Ende gefunden hat. Die Gemeindeidee bleibt ein ekklesiales Idyll, das Bild von der lebendigen sich selbst sorgenden Gemeinde das paradiesische Urbild gelingender Pastoral schlechthin – freilich wohl mehr Utopie als Vision. Sie ähnelt der Forderung nach einer Restauration des Gesundheitswesens mit zertifizierten Ersthelfern, die die Ober- und Chefärzte ersetzen könnten, wenn sie denn nur das nötige Engagement mitbrächten.

Metanoia
Betrachtet man die pastoraltheologischen Diskurse der letzten Jahre und Jahrzehnte, dann kreisen viele von ihnen immer wieder um das Thema „Gemeinde“. Tatsächlich aber scheint der Diskurs keine echten Aufbrüche und Ideen zustande gebracht zu haben. Es scheint, als sei das große Verkündigungsprojekt der Kirche in eine Sackgasse geraten, aus der man nicht kommen kann, indem man in immer neuen Anläufen vor die Mauer am Ende des Weges anrennt; das führt zwar zu Kopfschmerzen, nicht aber zu echten Fortschritten. Vielleicht wäre es eher an der Zeit, dem jesuanischen Ruf nach μετάνοια mehr Gehör zu schenken. Μετάνοια ist mehr als bloße Umkehr. Μετάνοια bedeutet zuerst ein Umdenken, das Einnehmen einer neuen Perspektive und von hierher das Gehen neuer Wege. Das führt nicht zuletzt vor die Frage: Hat Jesus überhaupt Gemeinde gewollt?
Gemeinde als Kontrastgesellschaft?
Die pastoraltheologische Diskussion um die Gemeindeidee geht nicht zuletzt von dem Grundaxiom aus, die Gemeinde sei eine auf Jesus selbst zurückgehende Form der Verwirklichung der Kirche. Nicht zuletzt die einflussreiche Schrift des Neutestamentlers Gerhard Lohfink „Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?“8) hat zu einer starken Fundierung dieses Konzeptes beigetragen. Inbesonderes Gerhard Lohfinks Schlagwort von der „Kirche als Kontrastgesellschaft“ spielt eine subtile Rolle. Die Gemeinde soll gar eine „Gegengesellschaft“ sein9), die dem von ihm herausgestellten biblische Grundprinzip folgt,
„das man die Heiligkeit der Gemeinde nennen könnte. Die Kirche ist nicht mehr nur durch die Erlösungstat Christi geheiligt, sie hat diese Heiligung auch in einem entsprechenden Leben zu realisieren. Sonst gleicht sie sich der Welt an.“10)
Gerhard Lohfink konstatiert unumwunden ein scharfes Gegenüber von Gemeinde und Welt in den biblischen Texten, vor allem in den johanneischen Schriften11). Er stellt abschließend fest:
„Vielleicht ist es ein Segen, dass uns heute die Illusion, in einer im ganzen christlichen Gesellschaft zu leben, endgültig und gründlich zerschlagen wird. Das könnte den Blick dafür schärfen, dass die Kirche ihren eignen Weg gehen muss.“12)
Von der Einschätzung Gerhard Lohfinks ist der Weg nicht weit zu den viel beschworenen und rhetorisch hochvalenten Schlagworten von der „Entweltlichung der Kirche“ und dem „heiligen Rest“ der kleiner werdenden Herde. In manchen Gemeinden zeitigt dieses Konzept bereits erste Konsequenzen, wenn unter dem Motto „Klasse statt Masse“ der Auftrag des Auferstandenen, in alle Welt zu gehen und das Evangelium allen Geschöpfen zu bringen (vgl. Markus 16,15) mit elegantem rhetorischen Kniff ausgekontert wird.
Icons
Die die pastoraltheologische Diskussion prägende Idee Gerhard Lohfinks geht freilich nicht davon aus, dass Jesus in seiner Sendung den heiligen Rest Israels sammeln wollte:
„Er [Jesus] bleibt bei seinem Anspruch auf Gesamt-Israel. Die Vorstellung eines heiligen Restes oder einer Sondergmeeinde innerhalb Israels kommen für die Deutung des Jüngerkreises allein deshalb nicht in Frage, weil Jesus nirgendwo die Zugehörigkeit zu seinem Jüngerkreis als Bedingung für den Eintritt ins Gottesreich formuliert.“13)
Vielmehr soll der Jüngerkreis das endzeitliche Gottesvolk präfigurieren, als zeichenhaft darstellen, was Israel werden soll14):
„Was sich in Jesu Jüngerkreis und über ihn hinaus als Initiation des endzeitlichen Israel abzeichnet, ist mehr als nur eine ideelle Gemeinschaft, ist mehr als eine societas in cordibus. Hier herrschen nach dem Willen Jesu andere Sozialbeziehungen als in der übrigen Gesellschaft: Es gibt keine Wiedervergeltung, es gibt keine Herrschaftsstrukturen mehr. Schon allein daran wird deutlich, das es um sehr reale gesellschaftliche Wirklichkeit geht.“15)
Für Gerhard Lohfink scheint damit festzustehen, dass Jesus selbst eine Gemeindeidee vorgegeben hat. Der Jüngerkreis bildet die Grundidee gemeindlicher Konzeption vor. Das Miteinander Jesu mit denen, die ihm nachfolgen wird zur Ikone gemeindlicher Existenz. Es lohnt sich daher, dieses Miteinander näher zu betrachten.
Sammlung ...
Nach dem Zeugnis der synoptischen Evangelien dürfte das öffentliche Wirken Jesu nicht mehr als ein Jahr betragen haben16). Weite Teile des Lebens Jesu liegen im Dunkel der Geschichte verborgen. Irgendwann muss er Nazareth verlassen und sich in Kafarnaum niedergelassen haben. Hier am See Genezareth beginnt sein eigentliches öffentliches Wirken – vielleicht initiiert durch die Taufe am Jordan und seine 40tägige Wüstenzeit. Rasch verbreitet sich sein Ruf. In diesem galiläischen Frühling der Anfangseuphorie scheint vieles möglich. Und sein Ruf verbreitet sich über Kafarnaum hinaus. So heißt es bei Lukas:
Bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern wegzugehen Er sagte zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden; denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen Judäas.
Wer seinen Einflussbereich derart – eben auch geografisch – ausdehnt, braucht Mitarbeiter. Es wundert nicht, dass im unmittelbaren Anschluss an die Aufbruchsperikope von der Berufung der ersten Jünger berichtet wird (vgl. Lukas 5,1-11). Es ist bezeichnend, dass Jesus bodenständige Leute aussucht: Simon Petrus, Jakobus und Johannes sind nach Lukas die ersten, die er anspricht. Es sind just diese drei, die noch häufiger Erwähnung finden werden. Sie sind es, die seine Verklärung auf dem Tabor miterleben (vgl. Markus 9,2-10parr), sie begleiten ihn in seiner letzten Stunde vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane (vgl. Markus 14,32-42parr) und selbst in der frühen aufbrechenden Kirche werden diese drei von Paulus als diejenigen bezeichnet,
die als die ‚Säulen’ Ansehen genießen.
... einer Gemeinschaft auf Zeit
Um diese drei herum hat sich in Galiläa offenkundig schnell eine Jüngerschaft gebildet, die Jesus mehr oder weniger dauerhaft begleitet und ihm zugearbeitet hat. Zuerst sind es die Zwölf, die er aussendet – sicher eine symbolische Reminiszenz an die zwölf Stämme Israels (vgl. Markus 6,7-13parr); später sind es sogar 72 Jünger, die er beauftragt, seine Botschaft in die Lande zu tragen (vgl. Lukas 10,1-16par). Die Nachfrage, die Jesus geweckt hatte, muss hoch gewesen sein.
Es ist freilich kaum anzunehmen, dass selbst die drei Ersterwählten ihr Fischerhandwerk dauerhaft verlassen haben. Sie hatten Familie und mussten diese ernähren. Wie sehr sich hier jede Idealisierung verbietet, zeigen die Auferstehungsberichte. Die alte Markustradition weiß, dass die Jünger nach Galiläa zurückkehrten (vgl. Markus 16,7 sowie Matthäus 28,16). Im Johannesevangelium wird schließlich von Erscheinungen des Auferstandenen am See Gensareth berichtet (vgl. Johannes 21,1-14), wobei eine der lukanischen Berufungserzählung angenäherte Begebenheit berichtet wird. Selbst nach der Auferstehung verstehen sich die zwölf Apostel noch nicht als kirchliche Gemeinschaft. Sie sind nach der Katastrophe des Kreuzes zu ihren Familien zurückgekehrt. Es war halt eine Gemeinschaft auf Zeit, die da mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war.
Vergrößern

Der Weg nach Jerusalem als Paradigma
Dieser Weg nach Jerusalem sollte sich in viel späterer Rückschau als prägend herausstellen. Anlass für den Aufbruch ist nach dem Lukasevangelium die Warnung einiger Pharisäer, dass Herodes ihn töten lassen wolle (vgl. Lukas 13,31). Es besteht kein Zweifel: Wer öffentliche Relevanz gewinnt und soziale Veränderungen anmahnt, wird in Konflikt mit den Herrschenden geraten. Für Jesus steht aber noch mehr auf dem Spiel. Seine Mission kann nur in Jerusalem, der heiligen Stadt des Tempels, an ihr Ziel gelangen:
Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiterwandern; denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen.
In Jerusalem also wird sich zeigen, ob sein Ziel der Restitution Israels erreicht wird. Die Hoffnungen, die man in ihn setzte waren groß. Viele haben ihn anfänglich begleitet. Er aber mahnt:
Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben geringachtet, dann kann er nicht mein Jünger sein Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.
Dieses Wort Jesu wird gemeinhin als Aufforderung zur Radikalnachfolge gelesen. Faktisch aber geht es um etwas Anderes. Wenige Sätze später spricht er bildhaft vom Krieg:
Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden.
Genau so dürfte ihm seine Mission erschienen sein: Er weiß, dass er in einen Konflikt gehen wird, eine harte und auch gefährliche Auseinandersetzung, die keine Kompromisse duldet. Er braucht jetzt Leute um sich, die mit ganzem Herzen bei der Sache sind, die sich durch nichts ablenken lassen. Von hierher ist der Verzicht auf familiäre Bindungen zu verstehen. Es ist ein Verzicht auf Zeit, bis die Entscheidung in Jerusalem gefallen ist.
Wie sehr sich gerade der engste Jüngerkreis auf eine konfliktive Auseinandersetzung vorbereitet hat, zeigt nicht nur, dass selbst der Fischer Simon Petrus bewaffnet war (siehe Markus 14,47parr); man verteilt auch schon einmal die Ämter und Posten für eine eventuelle Machtübernahme (vgl. Markus 9,33-37parr). Das alles wird sich freilich als grandioses Missverständnis herausstellen. Die Gefolgschaft Jesu wird zuerst als sinnlose Niederlage interpretiert werden, die zu einer kopflosen Flucht nach seiner Verhaftung führt. Erst in der Rückschau nach der Auferstehung und einer erneuten Sammlung wird der Weg nach Jerusalem als Initiation erscheinen, die aus denen, die ihm in der Zeit nachfolgten, Verkünder der frohen Botschaft vom angebrochene Reich Gottes unter den Menschen macht.
Immer wieder neu aufwachen
Hat Jesus also überhaupt Gemeinde gewollt? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Er hat sich eine Gemeinschaft auf Zeit berufen. Erst aus der Auferstehungserfahrung heraus hat diese Gemeinschaft neu zueinander gefunden. Es ging aber nie um die Gemeinschaft an sich. Die Gemeinschaft war bestenfalls Methode zur Verkündigung des Evangeliums vom angebrochenen Reich Gottes.
Freilich gehört es zur conditio humana, dass ich Gemeinschaften institutionalisieren und vergesellschaften. Dieser Prozess ist bereits in den frühen neutestamentlichen Schriften erkennbar. Dabei liegt für den in Bochum lehrenden Neutestamentler Thomas Söding
„die Keimzelle der gesamten nachösterlichen Entwicklung (…) im Wirken Jesu für die Herrschaft Gottes“17).
So unterschiedlich die Konzeptionen und Bilder von Kirche sein mögen, sie alle setzen bei der Verkündigungspraxis Jesu selbst an. Mit der Zeit ist dabei ein
„Prozess der allmählichen Konsolidierung und sturkutrellen Verfestigung in den Gemeinden“18)
zu verzeichnen, der sich aufgrund des neutestamentlichen Textbefundes vor allem im paulinischen Missionsraum beobachten lässt. Es entstehen Strukturen, Ämter und Institutionen. Erst spät entsteht also das Urbild dessen, was man heute als Gemeinde bezeichnen kann. Es ist vor allem dem menschlichen Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit geschuldet, das immer auch Gefahren mit sich bringt. Die feste Form und die bloße Zugehörigkeit zu einer Gemeinde scheint nämlich mit quasi-logischer Konsequenz immer auch zur Ermüdung und Erschlaffung des Verkündigungswillens zu führen. So wendet sich der Autor der Johannesoffenbarung am Beginn seines Textes in sieben Sendschreiben an die adressierten Gemeinden, wobei er sie meist motivieren muss, zur alten Glaubensstärke zurückzufinden und sich faulen Kompromissen zu verweigern. Lediglich die Gemeinde von Philadelphia kann seinen Ansprüchen genügen:
Ich kenne deine Werke, und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft, und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet.
Mehr Theologie wagen!
Soviel Glaubensmut hätte sich auch der Prediger von der Gemeinde gewünscht, an die sich das Schreiben an die Hebräer wendet. Er erinnert die einst glaubensstarke Gemeinde geradezu anklagend an ihre Ursprünge:
Darüber hätten wir noch viel zu sagen; es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch die Anfangsgründe der Lehre von der Offenbarung Gottes beibringt; Milch habt ihr nötig, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtiges Reden zu verstehen; er ist ja ein unmündiges Kind; feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden.
Die Mitglieder der Gemeinde müssten längst selbst schon Lehrer sein, Verkünderinnen und Verkünder, die authentisch in Wort und Tat das Evangelium vom angebrochenen Reich Gottes bezeugen. Doch sie begnügen sich mit zu wenig. Sie benehmen sich wie Kinder, die mit banalen Spielchen glauben, das Wesentlich erfasst zu haben – sie genügen sich selbst. Das Rezept des Predigers ist eindeutig:
Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkünden muss, und uns dem Vollkommeneren zuwenden. (…) Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt, damit ihr nicht müde werdet, sondern Nachahmer derer seid, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißungen sind.
Gemeinde in actu!
Das alte Rezept gilt auch heute noch: Gemeinde hat in sich keinen Wert – Gemeinde ist Methode, ein Weg der Verkündigung. Verkündigung geht aber immer nach außen in die Welt. Jede Sammlung führt letztlich zur Sendung. Dem Beispiel Jesu folgend kann das sogar eine Sendung auf Zeit sein. Das Ziel ist nicht, Gemeinden zu gründen, sondern das Evangelium vom angebrochenen Reich Gottes unter den Menschen, die frohe Botschaft des vom Kreuzestod Auferstandenen in die Welt zu tragen. Was nützen schon die schönsten Gemeindeideen, die in den pastoralen Instituten ersonnen werden, wenn dort doch nur Milch gemolken wird, statt das Schwarzbrot ehrlicher weltzugewandter Theologie zu backen. Was wäre denn, wenn die vielzitierte Behauptung wirklich stimmt, dass die Menschen Gott suchen würden. Sind da heute noch Jüngerinnen und Jünger Jesu die freimütig wie weiland Philippus dem Natanaël antworten:
Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben: Jesus aus Nazaret, den Sohn Josefs.
Oder heben sie ohnmächtig die Hände und behaupten, sie müssten erst einmal selbst suchen? Selig aber ist, wer Antworten auf die Fragen der Menschen hat. Es ist wieder Zeit, echte Theologie zu wagen.
Bildnachweis
Titelbild: Walking the labyrinth at Chartres Cathedral (Cathédrale Notre-Dame de Chartres) in Chartres, France (Maksim) – Quelle: Wikicommons – lizenziert als CC BY-SA 3.0.
Bild 1: A labyrinth in Grace Cathedral, San Francisco (Marlith) – Quelle: Wikicommons – lizenziert als CC BY-SA 3.0.
Bild 2: Hortus Deliciarum, Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen (Herran von Landsberg – ca. 1180) – Quelle: Wikicommons – lizenziert als gemeinfrei.
Video: Kath 2:30 – Episode 13: Gemeinde oder Gemeinschaft – Teil 3 (Katholische Citykirche Wuppertal/Christoph Schönbach) – Quelle: Vimeo – alle Rechte vorbehalten.
Dieser Beitrag ist die erweiterte, ergänzte und aktualisierte Version des gleichnamigen Beitrages, der im Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück, 11/2016, S. 323-328 erschienen ist.
Einzelnachweis
| 1. | ↑ | Hierzu wurden etwa zu Beginn des Jahres 2017 zwei große Kongresse in Bochum und Hannover abgehalten. In Bochum ging des Zentrum für angewandte Pastoralforschung (ZAP) im Rahmen eines Kongresses am 13./14. Februar 2017 dem Thema „Für eine Kirche, die Platz macht“ nach (mehr unter http://www.zap-kongress.de/Organisation.html [Stand: 19. Februar 2017], während das Bistum Hildesheim und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannover in Hannover am 14./15. Februar 2017 mit „W@nder“ (sic!) eine Konferenz für Pioniere veranstalteten – oder besser „eine Konferenz in der Eisfabrik Hannover für alle Wandernden und Wundernden in der Kirche und drumherum“ (http://www.kirchehochzwei.de/cms/wander [Stand: 19. Februar 2017]). |
| 2. | ↑ | Fresh Expressions – Kirche auf dem Weg, Quelle http://www.kirchehochzwei.de/cms/content/fresh-expressions-kirche-auf-dem-weg [Stand: 19. Februar 2017]. |
| 3. | ↑ | Vgl. hierzu Herbert Haslinger, Gemeinde – Kriche am ort. Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils, Paderborn 2015, S. 18ff. |
| 4. | ↑ | Vgl. hierzu Herbert Haslinger, Gemeinde – Kriche am ort. Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils, Paderborn 2015, S. 20ff. |
| 5. | ↑ | Franz-Xaver Kaufmann, Kirche begreifen. Analysen und Thesen zur gesellschaftlichen Verfassung des Christentums, Freiburg i. Br. 1979, S. 100. |
| 6. | ↑ | Herbert Haslinger, Gemeinde – Kriche am ort. Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils, Paderborn 2015, S. 25. |
| 7. | ↑ | So auch Herbert Haslinger, Gemeinde – Kriche am ort. Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils, Paderborn 2015, S. 11 |
| 8. | ↑ | Vgl. Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982. |
| 9. | ↑ | Vgl. Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 142. |
| 10. | ↑ | Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 149f (Hervorhebung im Original). |
| 11. | ↑ | Vgl. Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 150. |
| 12. | ↑ | Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 154. |
| 13. | ↑ | Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 46. |
| 14. | ↑ | Vgl. Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 46. |
| 15. | ↑ | Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg i.Br. 1982, S. 88 (Hervorhebung im Original). |
| 16. | ↑ | Das Johannesevangelium weicht von dieser Konzeption ab und schildert ein dreijähriges öffentliches Wirken Jesu. Ohne näher in die chronologischen Diskussionen eingehen zu können, erscheint die synoptische Tradition hier ursprünglicher, weil Johannes sein Evangelium offenkundig stärker als Interpretament auch der synoptischen Tradition versteht. So wird beispielsweise der fehlende Einsetzungsbericht wird durch die große Brotrede in Johannes 6 sowie die Erzählung von der Fußwaschung in Johannes 13,1-20 nicht bloß kompensiert, sondern interpretiert. Es geht Johannes also um mehr als um die bloße Wiedergabe der bereits in den synoptischen Evangelien überlieferten Jesustradition; es geht um die rechte Interpretation. |
| 17. | ↑ | Thomas Söding, Blick zurück nach vorn. Bilder lebendiger Gemeinden im Neuen Testament, Freiburg i.Br. 1997, S. 21. |
| 18. | ↑ | Thomas Söding, Blick zurück nach vorn. Bilder lebendiger Gemeinden im Neuen Testament, Freiburg i.Br. 1997, S. 21. |
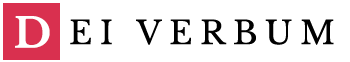





Das ist jetzt aber ein Thema aus den Anfängen der 90iger (Lohfink). Wir sind jetzt wohl soweit, dass wir nicht verneinen können, dass die Theologie auf Bibel und Tradition aufbaut (der hl Geist muss ja auch was zu tun haben). In der Praxis wissen wir Seelsorger sehr wohl, dass es neben den Strukturen noch Inhalt braucht. Aber ohne Gemeinschaft (Gemeinde) gibt es kein Christentum!
Sehr geehrter Herr Piller, vielen Dank für Ihren Kommentar. Die Aussage, das christliche Glaube nur in Gemeinschaft möglich sei, wird oft wiederholt meist bleibt aber ungeklärt, was unter Gemeinschaft zu verstehen ist. Die In-Eins-Setzung von Gemeinschaft und Gemeinde hakte ich so für nicht unproblematisch. Communio im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils meint ja zuerst die Gemeinschaft mit Gott und erst von hier aus die Gemeinschaft der Menschen untereinander. Und da ist noch nicht gesagt, dass diese Gemeinschaft dauerhaft im Sinne einer Gemeinde sein muss. Genau darauf hebe ich ab. Ich Stimme Ihnen zu, das glaube Gemeinschaft braucht; aber braucht ett auch “Gemeinde” im herkömmlichen Sinn statisch territorialer Zuschreibungen? Da denke ich, müssen wir eben umdenken und dynamische Konzepte von Communio, wie sie ja auch in Mt 18,20 aufscheinen, in die Überlegungen mit einbeziehen. Darum geht es mir bitte allem. Das können dann durchaus Weggemeinschaften auf Zeit sein.
Nur nebenbei bemerkt: im großen Glsubensbekenntnis kommt die Gemeinschaft gar nicht vor, wohl aber die Kirche als Ergebnis des dynamischen Wirkens des Heiligen Geistes. Es geht also weniger um die Frage “Gemeinschaft ja oder nein”, sondern um die Frage “Stasis oder Dynamik”.
W. Kleine
Die Frage ist nur die nach der Ausrichtung. Braucht Kirche Gemeinde, oder braucht Gemeinde Kirche?
http://theosalon.blogspot.de/2016/02/servicezeit.html?m=1
Zudem ist nicht unspannend, dass wir jetzt weiter als in den 90ern wären (in denen man noch verneinen konnte, dass Theologie auf Bibel und Tradition aufbaut?) ?
In Aachen oft übersehen wird die Idee der “Gemeinschaft der Gemeinden”, die gern mit der Zusammenlegung der Gemeinden identifiziert wird. Der theologischen Gedanke war aber der, dass es mehr Gemeinden/Gemeinschaften gibt, als die Gemeinden, die sich um einen Kirchturm gebildet haben.
Meine Firmbewerbern bilden um Beispiel noch bis Juli kleine Gemeinden auf Zeit und müssen nach meinem Verständnis auch nicht in bestehende territoriale Gemeinden hineingefirmt werden.
Vielleicht ist einfach der Begriff “Gemeinde” in sich missverständlich, weil er eben rein erfahrungsbezogen – oder um es anders zu sagen: konstruktivistisch bedingt – auf das kirchenrechtliche Phänomen “Pfarrei” bezogen wird, was ja lange Zeit deckungsgleich war. Möglicherweise ist es anders Zeit, hier einen neuen Begriff zu prägen, denn “Gemeinschaft der Gemeinden” ist von der Herkunft her zumindest assoziativ auf die Zusammenlegung von Pfarreien ausgerichtet.
In Limburg sollen es Bischöfliche Seelsorgeeinheiten gewesen sein… bis man merkte, dass sich das schlecht abkürzen lässt. ?
Ich finde diesen rk AKüFi (Abkürzfimmel) sehr merkwürdig … 😉
Die teiloffene Tür als ToT zu bewerben fand ich schon komisch. Aber dann gab’s noch die kleine offene Tür.
Und die drucken die Abkürzungen sogar auf Flyer… ?
Tobias Kölling Das spricht nicht unbedingt für ein ausgeprägtes Sprachbewusstsein – und das ist m.E. durchaus im Bereich derer, die das Wort Gottes verkünden sollen, Grundvoraussetzung. Hier liegt meines Erachtens ein Hauptproblem. Deshalb plädiere ich ja dafür, statt pastoraltheologisch permanent neue gemeindetheologische Konzepte zu entwerfen, deren kirchenrechtliche Machbarkeit einmal beiseite gelassen wird, die Kompetenzen in den Bereichen Rhetorik und Theologie auszubauen.
Seelsorgekonzepte hin oder her.. Gemeinschaft gehört trotzdem zwingend zum Christentum!
Daran zweifelt hier keiner und ich glaube Ihr Anliegen, lieber Florian Piller, zu verstehen. Die Frage ist nur, wie Gemeinschaft definiert wird. Reicht es, einfach zusammen zu sein, ist liturgische Gemeinschaft gemeint, die Zusammenkunft im Namen Jesu mit dem Ziel des Handelns aus Nächstenliebe, genügt menschliche Gemeinschaft oder ist es das Bewusstsein der Gemeinschaft mit Gott? Der Begriff der Gemeinschaft ist in sich zu diffus, um ihn zugrund zu legen. Da verstehen viele vieles, wenn nicht gar alles oder nichts darunter. Ist etwa eine Liturgie, bei der sich im Alltagsgottesdienst eine Handvoll Mensch statistisch gleichmäßig im Kirchenraum verteilen schon ein Gemeinschaftserlebnis? Fragen über Fragen …
Angenendt ist zu dem Thema mal sehr deutlich geworden. Speziell dass die Gemeinschaft mit Gott sinnlich fühlbar werden muss und kann. Wenn ichs finde teil ichs hier…
Tobias Kölling Das wäre spannend, wobei sich die Frage nach einer sinnlichen Fehlbarkeit angesichts Exodus 33,18-23 in sich noch einmal zu hinterfragen wäre. Zumindest biblisch ist Gottesbegegnung eigentlich nie unmittelbar, sondern immer vermittelt. Was bedeutet das für die “sinnliche Fühlbarkeit”?
Zumindest bei wars Fühlbarkeit… Aber sinnliche Fehlbarkeit würde viel im rk System erklären… ?
Tobias Kölling 😉 – Manchmal macht mich diese Autokorrektur wahnsinnig … Danke für den Tipp, ist geändert.
Die Frage ist nur ob wir wirklch weiter sind, wenn immer noch um die gleiche Frage diskutiert wird. .. und zum ersten Satz: was war zurrst, das Huhn oder das Ei?
Na ja, da scheint mir ein etwas schräger Vergleich zu sein. Die Frage ist eher: Ist das Huhn da, Eier zu legen, oder reicht es ihm, auf der Stange zu sitzen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass Gemeinden unnütz sind. Bloß sind sie nicht Ziel, sondern Methode der Verkündigung.
Die Frage, wozu das Huhn da sei,-
Eier zu legen oder auf der Stange zu sitzen, …
Danke dafür, ein großartiges Bild!
Es mutet mich eteas komisch an, wenn man Inhalt proklamiert und über Abkürzungen diskutiert…
Nicht über Abkürzungen. Über Weltbewegendes, Verständlichkeit und theologischen Gehalt. ?
Florian Piller In dem Hang zur Abkürzung verbirgt sich ja auch eine Abgrenzungsmentalität. Ich muss schon eingeweiht sein, um Abkürzungen wie “GdG” oder “SB” usw. zu verstehen. Neutestamentlich aber wäre die Mahnung des Paulus zu berücksichtigen, so zu reden und zu feiern, dass auch die, die noch fern stehen, verstehen, worum es geht. Da erscheint die Abkürzung fast schon wie die Zungenrede, die es nicht braucht, weil sie für die Verkündigung nichts austrägt, sondern sich selbst genügt. Von daher ist die Diskussion über die Abkürzungen nicht ganz so abwegig.
Und nur nebenbei bemerkt: Das ist mit ein Grund, warum wir in unseren Weblogs http://www.dei-verbum.de und http://www.kath-2-30.de Bibelstellen nicht nach den Loccumer Richtlinien abkürzen, sondern ausschreiben – wer kennt schon immer die Auflösung der entsprechenden Kürzel? Das grenzt ja eher aus als das es Gemeinschaft stiftet.
Wenn Jesus Bedingungen formuliertdie zum Ausschluss führen
(Mt 18,15-20), hat er dann einezu seinen Lebzeiten bestehende Gemeinde gemeint?
Das Problem dürfte sein, dass es zu Lebzeiten Jesu eben keine christliche Gemeinde gab; die bildet sich ja erst nachösterlich. Und von hier aus sind auch die Formulierungen in Mt 18,15-20 zu lesen – sie betreffen die nachösterliche Gemeinde, wobei der Begriff “Gemeinde” schon missverständlich ist. Im griechischen Urtext steht hier das Wort ἐκκλησία (ekklesia), das wörtlich “die Versammlung” meint. Das wiederum ist ein in sich weiter Begriff, der auch völlig profan verwendet wird (die Griechen verwendeten diesen Terminus, um damit ihre Versammlungen der Polis auf der Agora zu bezeichnen). Man darf ihn also streng genommen gar nicht eingrenzen. Die Weisungen Jesu gehen also weit über eine wie auch immer gedachte, zu Zeiten Jesu aber eben noch gar nicht existente Christengemeinde hinaus. Es geht um das Miteinander an sich – eben auch in der Gemeinde (dafür spricht die Verwendung der Wortes “Bruder”).